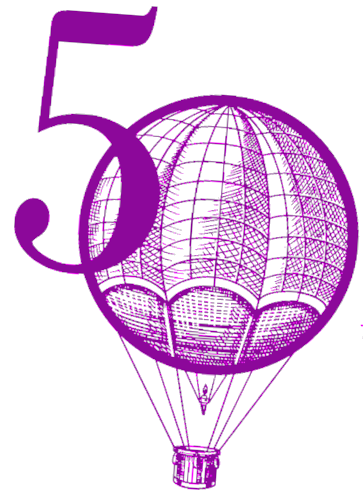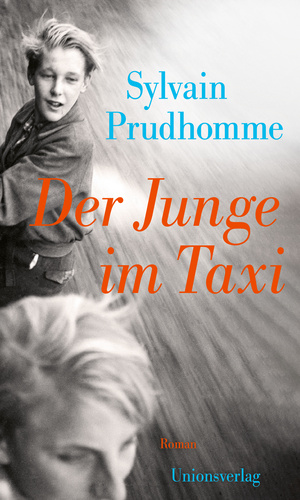Sylvain Prudhomme
»Urplötzlich packte es mich – beharrlich und unwiderstehlich – ich musste einfach das Geheimnis ergründen.«
Ein Interview
Heinz Gorr: Woher kam die Inspiration zu Der Junge im Taxi?
Sylvain Prudhomme: Am Anfang stand eine Familiengeschichte. Das heißt, ich als Autor des Buchs, auch wenn es als Fiktion daherkommt und der Erzähler Simon und nicht Sylvain heißt, ich habe die Initialszene exakt so erlebt, wie sie im Buch steht. Bei Großvaters Beerdigung kam jemand auf mich zu und flüsterte mir ins Ohr, dass dieses verheimlichte Kind existiere. Mein Schreiben nimmt eigentlich immer solche Ausgangspunkte, oft sind es Emotionen, wie sie mir im richtigen Leben begegnen. Als mir vor ungefähr acht Jahren dieses Geheimnis enthüllt wurde, war das ein Schock für mich. Fast zeitgleich verspürte ich das Bedürfnis, diesem Familiengeheimnis nachzuspüren und wenig später auch, dem Stoff eines Tages ein Buch zu widmen. Lange habe ich diesen Gedanken mit mir herumgetragen, er war stets präsent, aber erst vor Kurzem fand ich den Mut, das Buch zu schreiben und ihm diese Form zu geben.
Nachdem ich die Neuigkeit erfahren hatte, kam ein zweiter Schock hinzu: Denn schon einmal hatte ich diesen [jetzt verstorbenen H.G.] Großvater Malusci als Figur in meinem Buch Là, avait dit Bahi beschrieben, es ist 2012 erschienen und wurde nicht ins Deutsche übersetzt. Darin schicke ich Malusci nach Algerien, kurz vor dem Ende des Algerienkriegs. Der Roman handelt von seinem früheren Leben als Landwirt. Sein ehemaliger Angestellter berichtet dem Erzähler: »Ach, dein Großvater hat immer von ›der Deutschen‹ vom Bodensee gesprochen.« Da wurde mir schockartig bewusst, dass ich von diesem Geheimnis zwar bereits wusste, seine Tragweite jedoch nicht begriffen hatte: Mir war schon klar, dass es sich um eine Liebesgeschichte handelte, keineswegs aber, dass es ein Kind gab. Und urplötzlich packte es mich – beharrlich und unwiderstehlich – ich musste einfach darüber reden, es ergründen. Denn zunächst glaubte ich ja, ein Geheimnis gelüftet zu haben. Tatsächlich war es aber nur ein winzig kleiner Teil davon.
Dann trifft es also auch zu, dass Ihr eigener Großvater in Algerien gelebt hat zur Zeit des Unabhängigkeitskriegs?
Auch das ist ziemlich authentisch, ja. Ich glaube, es wäre mir nicht möglich gewesen, eine solche Fiktion aus dem Nichts zu schöpfen, das hätte ich als zu willkürlich empfunden. Ich brauche eine Affinität zu den Fragen, die meine Figuren umtreiben. Mit Der Junge im Taxi habe ich diese Geschichte rekapituliert in der Person des Erzählers Simon und des Großvaters Malusci, die Fiktion jedoch basiert auf der Heftigkeit einer familiären Situation, die ich selbst so durchlebt habe. Für mich war es wirklich ein Schock, zu entdecken, dass die eigene Familie ein derart enormes Geheimnis verbergen konnte, einfach so, vierzig Jahre lang. Und wie konnte sich, nachdem es raus war, das Familienoberhaupt dermaßen vehement dagegen sträuben, dass jemand mehr wissen mochte, und jene zurückstoßen, die Fragen stellten? Fragen, die zum Leben vieler Familien gehören, die nach meinem Gefühl geradezu universell sind. Dieser massive Widerstand hat mich bestärkt, davon zu erzählen, wie sich jeder Einzelne die Vergangenheit zurechtlegt, sich mit ihr abfindet, versucht, sich mit dem Erlebten zu arrangieren oder es auszulöschen; sich entscheidet, wovon er sprechen, worüber er schweigen möchte.
Spielte es bei all dieser Geheimniskrämerei eine Rolle, dass die Mutter des Kinds dem langjährigen »Erzfeind« Frankreichs angehörte und eine Deutsche war?
Zunächst muss man sagen, es war ja ein Kind, das vor der Ehe gezeugt wurde, nicht außerehelich, es lag also kein Ehebruch vor. Aber natürlich war das ein lästiges Kind, aus einem früheren Leben, und – ganz klar – ein Kind des damaligen »Feindes«, ja. Diese Fälle waren alltäglich, auch umgekehrt gab es viele Kinder deutscher Väter mit Französinnen. Ich wollte von diesem ganzen Erbe erzählen, den Fragen, mit denen sich beide Nationen konfrontiert sahen: Es gab diesen Krieg, der die Familien Hunderttausender oft noch viel enger zusammengeschweißt hat, und auf einmal stehen beide Seiten vor der Frage: Was tun mit all diesen Kindern? Auch im vorliegenden Fall, als es darum ging, das verheimlichte Kind M. anzunehmen, spielte es in der unmittelbaren Nachkriegszeit sicher eine Rolle, dass er als Kind des Gegners, des Feindes galt, selbstverständlich!
Frankreich dürfte da auch einiges an Erfahrung haben, blickt man allein auf die lange Kolonialgeschichte …
Ja, das gibt es oft in Frankreich, all die Kinder der Kolonisten in Algerien, in Afrika … Das hat mich schon immer interessiert. Doch sehr wahrscheinlich hätte ich nie darüber geschrieben, wenn diese Frage nicht in meiner Familie aufgetaucht wäre. Ich brauche immer so einen besonderen Fall, der mich quasi hautnah berührt, denn jeder dieser Fälle spiegelt die kollektive Geschichte wider. Es ist das Material, das das Leben bereitstellt, auf dem ich mein Schreiben aufbaue. Mir gezielt ein Sujet auszusuchen und vorzunehmen – so gehe ich nicht vor. Wenn man ein bisschen gräbt und recherchiert, findet man in jeder französischen oder deutschen Familie, in der engeren oder weiteren Verwandtschaft, solche blinden Flecken, denke ich. Wie haben die Eltern das erlebt, was ist damals passiert, wie hat sich der Vater verhalten, wurde ein Kind zurückgelassen, welche Art von Missbilligung hat die Mutter erfahren …? Im Roman ging ich eben von dem konkreten Fall des Jungen M. aus.
Während Simon, der Erzähler, den Spuren dieses M. folgt, durchlebt er eine Trennung von seiner Partnerin, mit der er zwei Kinder hat. Beruht auch dieser Aspekt auf einem autobiografischen Hintergrund?
Auch hier gehe ich von Erlebtem aus, allerdings war es meine Entscheidung, diese beiden Situationen zeitgleich geschehen zu lassen, das ist das Fiktive daran. Simon macht das alles simultan durch, die Opposition zur Familie, seine Trennung. Aus der Sicht des Romanciers fand ich es interessant, den Erzähler die Auflösung seiner eigenen familiären Zelle in dem Moment erleben zu lassen, als er entdeckt, dass auch seine Ursprungsfamilie Risse aufweist und zerbrechlich wirkt. Das fand ich spannend, weil schon die Trennung allein eine harte Konfrontation mit der Wirklichkeit bedeutet, bei der man sämtliche Illusionen verliert und ohne jeden Leuchtturm in einem Meer der Wahrheit unterwegs ist. Während solcher Phasen giert man nach Aufrichtigkeit, erträgt keine Lügen mehr, keinen falschen Schein. Das sind Momente, in denen man vieles verliert, anderes ist bereits zerstört, und plötzlich fürchtet man sich nicht mehr davor, mit dem Zerstören weiterzumachen. Ich wollte einen Erzähler, der keine Angst mehr davor hat, alle Masken fallen zu lassen. Er wird damit beinahe zur Gefahr für die familiäre Ordnung. Es war mir sehr wichtig, Simon verletzlich, zerbrechlich zu zeichnen, nicht als jemanden, der über allem schwebt, der meint, andere belehren zu können. Nein, er ist ja selbst gefangen in seinen Emotionen und Widersprüchen. Und so tritt er vor die Familie, die per se Ort gemischter Gefühle und unüberbrückbarer Konflikte ist. Simon ist ein Verlorener in all dem, was gleichzeitig über ihn hereinbricht. Und weil er allein ist, fühlt er sich M. auch so nahe, empfindet große Empathie.
Wie könnte man die Beziehung zwischen Simon und dem ihm unbekannten M. beschreiben?
Das Paradoxe ist, dass Simon sich M. nur als »verlassenes Kind« vorstellen kann. Auch wenn mehr als siebzig Jahre verstrichen sind, M. womöglich längst Vater, Großvater sein könnte, ist er für Simon zunächst nur ein Verlassener. Da ist auch eine gewisse Naivität seitens Simons im Spiel, und weil er selbst ein trostbedürftiger Mensch ist, wächst in ihm der Wunsch, diesen M. zu trösten. So entsteht eine Art Bruderschaft der Isolierten, eine emotionale Solidarität unter den vermeintlich Einsamen. M. wird für Simon zur Projektionsfläche, zum Inbegriff des Verlassenen, des absolut Unglücklichen. Natürlich ist M. viel mehr als das, das ist mir wichtig. Es zeigt sich, dass jede Existenz ihren Weg findet, und glücklicherweise niemandem eine starre Rolle, ein ganzes Leben im Unglück zugewiesen ist.
Das Buch ist ein Abriss der Zeitgeschichte des vergangenen Jahrhunderts: Der Zweite Weltkrieg, der Algerienkrieg, die Nachkriegszeit in Deutschland werden thematisiert, zugleich befinden wir uns mit dem Erleben des Erzählers in der Gegenwart. Was könnte der Roman jungen Leserinnen und Lesern von heute sagen?
Ich hoffe, dass das Buch Lust darauf macht, Fragen zu stellen und mit der eigenen Familie zu sprechen. Ich denke, es plädiert dafür, Geheimnisse ans Licht zu bringen, das Wagnis einzugehen, etwas anzusprechen. Häufig schweigt man in den Familien über bestimmte Dinge schlicht aus Gewohnheit, fast so, als gäbe es ein stummes Einverständnis: »Sprich das bloß nicht an, sag dies oder jenes niemals, du weißt, dass das ganz sicher Leid verursachen würde etc.« Aber genau damit, dass man nichts sagt, macht man den Schaden noch größer. Denn in dem Buch sieht man ja, wie sich diese Dinge unter der Oberfläche fortsetzen, dass sie umso mehr Konsequenzen haben, je weniger man von ihnen spricht. Es ist zu spüren, wie die nächste Generation eine Last, etwas Ungesagtes erbt, weil es eben nicht stimmt, dass alles, was man verschweigt, auch nicht existiert. Vielmehr füllt das Schweigen den Raum, es kann sogar alles ersticken, ist also nicht absent, sondern sehr präsent. Natürlich dreht sich das Buch um die französisch-deutsche Vergangenheit, den Zweiten Weltkrieg und die verheimlichten Besatzungskinder, die es in unzähligen Familien gibt. Doch das Wesentliche für mich sind diese Geheimnisse, jene Türen, hinter denen sich Menschen verbergen, Cousins, Schwestern, Halbbrüder, von denen wir wissen, dass es sie gibt, man uns aber verbietet, sie zu sehen, nur weil irgendwann Stillschweigen verabredet wurde. Doch solche Türen sind permanent in unserer Nähe, wir müssen nur anklopfen und sie öffnen – einzig wir selbst hindern uns daran, dies zu tun. So vieles lässt sich in Ordnung bringen, reparieren, indem man einfach an die Tür klopft.
Das Interview führte und übersetzte Heinz Gorr.
Heinz Gorr: Woher kam die Inspiration zu Der Junge im Taxi?
Sylvain Prudhomme: Am Anfang stand eine Familiengeschichte. Das heißt, ich als Autor des Buchs, auch wenn es als Fiktion daherkommt und der Erzähler Simon und nicht Sylvain heißt, ich habe die Initialszene exakt so erlebt, wie sie im Buch steht. Bei Großvaters Beerdigung kam jemand auf mich zu und flüsterte mir ins Ohr, dass dieses verheimlichte Kind existiere. Mein Schreiben nimmt eigentlich immer solche Ausgangspunkte, oft sind es Emotionen, wie sie mir im richtigen Leben begegnen. Als mir vor ungefähr acht Jahren dieses Geheimnis enthüllt wurde, war das ein Schock für mich. Fast zeitgleich verspürte ich das Bedürfnis, diesem Familiengeheimnis nachzuspüren und wenig später auch, dem Stoff eines Tages ein Buch zu widmen. Lange habe ich diesen Gedanken mit mir herumgetragen, er war stets präsent, aber erst vor Kurzem fand ich den Mut, das Buch zu schreiben und ihm diese Form zu geben.
Nachdem ich die Neuigkeit erfahren hatte, kam ein zweiter Schock hinzu: Denn schon einmal hatte ich diesen [jetzt verstorbenen H.G.] Großvater Malusci als Figur in meinem Buch Là, avait dit Bahi beschrieben, es ist 2012 erschienen und wurde nicht ins Deutsche übersetzt. Darin schicke ich Malusci nach Algerien, kurz vor dem Ende des Algerienkriegs. Der Roman handelt von seinem früheren Leben als Landwirt. Sein ehemaliger Angestellter berichtet dem Erzähler: »Ach, dein Großvater hat immer von ›der Deutschen‹ vom Bodensee gesprochen.« Da wurde mir schockartig bewusst, dass ich von diesem Geheimnis zwar bereits wusste, seine Tragweite jedoch nicht begriffen hatte: Mir war schon klar, dass es sich um eine Liebesgeschichte handelte, keineswegs aber, dass es ein Kind gab. Und urplötzlich packte es mich – beharrlich und unwiderstehlich – ich musste einfach darüber reden, es ergründen. Denn zunächst glaubte ich ja, ein Geheimnis gelüftet zu haben. Tatsächlich war es aber nur ein winzig kleiner Teil davon.
Dann trifft es also auch zu, dass Ihr eigener Großvater in Algerien gelebt hat zur Zeit des Unabhängigkeitskriegs?
Auch das ist ziemlich authentisch, ja. Ich glaube, es wäre mir nicht möglich gewesen, eine solche Fiktion aus dem Nichts zu schöpfen, das hätte ich als zu willkürlich empfunden. Ich brauche eine Affinität zu den Fragen, die meine Figuren umtreiben. Mit Der Junge im Taxi habe ich diese Geschichte rekapituliert in der Person des Erzählers Simon und des Großvaters Malusci, die Fiktion jedoch basiert auf der Heftigkeit einer familiären Situation, die ich selbst so durchlebt habe. Für mich war es wirklich ein Schock, zu entdecken, dass die eigene Familie ein derart enormes Geheimnis verbergen konnte, einfach so, vierzig Jahre lang. Und wie konnte sich, nachdem es raus war, das Familienoberhaupt dermaßen vehement dagegen sträuben, dass jemand mehr wissen mochte, und jene zurückstoßen, die Fragen stellten? Fragen, die zum Leben vieler Familien gehören, die nach meinem Gefühl geradezu universell sind. Dieser massive Widerstand hat mich bestärkt, davon zu erzählen, wie sich jeder Einzelne die Vergangenheit zurechtlegt, sich mit ihr abfindet, versucht, sich mit dem Erlebten zu arrangieren oder es auszulöschen; sich entscheidet, wovon er sprechen, worüber er schweigen möchte.
Spielte es bei all dieser Geheimniskrämerei eine Rolle, dass die Mutter des Kinds dem langjährigen »Erzfeind« Frankreichs angehörte und eine Deutsche war?
Zunächst muss man sagen, es war ja ein Kind, das vor der Ehe gezeugt wurde, nicht außerehelich, es lag also kein Ehebruch vor. Aber natürlich war das ein lästiges Kind, aus einem früheren Leben, und – ganz klar – ein Kind des damaligen »Feindes«, ja. Diese Fälle waren alltäglich, auch umgekehrt gab es viele Kinder deutscher Väter mit Französinnen. Ich wollte von diesem ganzen Erbe erzählen, den Fragen, mit denen sich beide Nationen konfrontiert sahen: Es gab diesen Krieg, der die Familien Hunderttausender oft noch viel enger zusammengeschweißt hat, und auf einmal stehen beide Seiten vor der Frage: Was tun mit all diesen Kindern? Auch im vorliegenden Fall, als es darum ging, das verheimlichte Kind M. anzunehmen, spielte es in der unmittelbaren Nachkriegszeit sicher eine Rolle, dass er als Kind des Gegners, des Feindes galt, selbstverständlich!
Frankreich dürfte da auch einiges an Erfahrung haben, blickt man allein auf die lange Kolonialgeschichte …
Ja, das gibt es oft in Frankreich, all die Kinder der Kolonisten in Algerien, in Afrika … Das hat mich schon immer interessiert. Doch sehr wahrscheinlich hätte ich nie darüber geschrieben, wenn diese Frage nicht in meiner Familie aufgetaucht wäre. Ich brauche immer so einen besonderen Fall, der mich quasi hautnah berührt, denn jeder dieser Fälle spiegelt die kollektive Geschichte wider. Es ist das Material, das das Leben bereitstellt, auf dem ich mein Schreiben aufbaue. Mir gezielt ein Sujet auszusuchen und vorzunehmen – so gehe ich nicht vor. Wenn man ein bisschen gräbt und recherchiert, findet man in jeder französischen oder deutschen Familie, in der engeren oder weiteren Verwandtschaft, solche blinden Flecken, denke ich. Wie haben die Eltern das erlebt, was ist damals passiert, wie hat sich der Vater verhalten, wurde ein Kind zurückgelassen, welche Art von Missbilligung hat die Mutter erfahren …? Im Roman ging ich eben von dem konkreten Fall des Jungen M. aus.
Während Simon, der Erzähler, den Spuren dieses M. folgt, durchlebt er eine Trennung von seiner Partnerin, mit der er zwei Kinder hat. Beruht auch dieser Aspekt auf einem autobiografischen Hintergrund?
Auch hier gehe ich von Erlebtem aus, allerdings war es meine Entscheidung, diese beiden Situationen zeitgleich geschehen zu lassen, das ist das Fiktive daran. Simon macht das alles simultan durch, die Opposition zur Familie, seine Trennung. Aus der Sicht des Romanciers fand ich es interessant, den Erzähler die Auflösung seiner eigenen familiären Zelle in dem Moment erleben zu lassen, als er entdeckt, dass auch seine Ursprungsfamilie Risse aufweist und zerbrechlich wirkt. Das fand ich spannend, weil schon die Trennung allein eine harte Konfrontation mit der Wirklichkeit bedeutet, bei der man sämtliche Illusionen verliert und ohne jeden Leuchtturm in einem Meer der Wahrheit unterwegs ist. Während solcher Phasen giert man nach Aufrichtigkeit, erträgt keine Lügen mehr, keinen falschen Schein. Das sind Momente, in denen man vieles verliert, anderes ist bereits zerstört, und plötzlich fürchtet man sich nicht mehr davor, mit dem Zerstören weiterzumachen. Ich wollte einen Erzähler, der keine Angst mehr davor hat, alle Masken fallen zu lassen. Er wird damit beinahe zur Gefahr für die familiäre Ordnung. Es war mir sehr wichtig, Simon verletzlich, zerbrechlich zu zeichnen, nicht als jemanden, der über allem schwebt, der meint, andere belehren zu können. Nein, er ist ja selbst gefangen in seinen Emotionen und Widersprüchen. Und so tritt er vor die Familie, die per se Ort gemischter Gefühle und unüberbrückbarer Konflikte ist. Simon ist ein Verlorener in all dem, was gleichzeitig über ihn hereinbricht. Und weil er allein ist, fühlt er sich M. auch so nahe, empfindet große Empathie.
Wie könnte man die Beziehung zwischen Simon und dem ihm unbekannten M. beschreiben?
Das Paradoxe ist, dass Simon sich M. nur als »verlassenes Kind« vorstellen kann. Auch wenn mehr als siebzig Jahre verstrichen sind, M. womöglich längst Vater, Großvater sein könnte, ist er für Simon zunächst nur ein Verlassener. Da ist auch eine gewisse Naivität seitens Simons im Spiel, und weil er selbst ein trostbedürftiger Mensch ist, wächst in ihm der Wunsch, diesen M. zu trösten. So entsteht eine Art Bruderschaft der Isolierten, eine emotionale Solidarität unter den vermeintlich Einsamen. M. wird für Simon zur Projektionsfläche, zum Inbegriff des Verlassenen, des absolut Unglücklichen. Natürlich ist M. viel mehr als das, das ist mir wichtig. Es zeigt sich, dass jede Existenz ihren Weg findet, und glücklicherweise niemandem eine starre Rolle, ein ganzes Leben im Unglück zugewiesen ist.
Das Buch ist ein Abriss der Zeitgeschichte des vergangenen Jahrhunderts: Der Zweite Weltkrieg, der Algerienkrieg, die Nachkriegszeit in Deutschland werden thematisiert, zugleich befinden wir uns mit dem Erleben des Erzählers in der Gegenwart. Was könnte der Roman jungen Leserinnen und Lesern von heute sagen?
Ich hoffe, dass das Buch Lust darauf macht, Fragen zu stellen und mit der eigenen Familie zu sprechen. Ich denke, es plädiert dafür, Geheimnisse ans Licht zu bringen, das Wagnis einzugehen, etwas anzusprechen. Häufig schweigt man in den Familien über bestimmte Dinge schlicht aus Gewohnheit, fast so, als gäbe es ein stummes Einverständnis: »Sprich das bloß nicht an, sag dies oder jenes niemals, du weißt, dass das ganz sicher Leid verursachen würde etc.« Aber genau damit, dass man nichts sagt, macht man den Schaden noch größer. Denn in dem Buch sieht man ja, wie sich diese Dinge unter der Oberfläche fortsetzen, dass sie umso mehr Konsequenzen haben, je weniger man von ihnen spricht. Es ist zu spüren, wie die nächste Generation eine Last, etwas Ungesagtes erbt, weil es eben nicht stimmt, dass alles, was man verschweigt, auch nicht existiert. Vielmehr füllt das Schweigen den Raum, es kann sogar alles ersticken, ist also nicht absent, sondern sehr präsent. Natürlich dreht sich das Buch um die französisch-deutsche Vergangenheit, den Zweiten Weltkrieg und die verheimlichten Besatzungskinder, die es in unzähligen Familien gibt. Doch das Wesentliche für mich sind diese Geheimnisse, jene Türen, hinter denen sich Menschen verbergen, Cousins, Schwestern, Halbbrüder, von denen wir wissen, dass es sie gibt, man uns aber verbietet, sie zu sehen, nur weil irgendwann Stillschweigen verabredet wurde. Doch solche Türen sind permanent in unserer Nähe, wir müssen nur anklopfen und sie öffnen – einzig wir selbst hindern uns daran, dies zu tun. So vieles lässt sich in Ordnung bringen, reparieren, indem man einfach an die Tür klopft.
Das Interview führte und übersetzte Heinz Gorr.