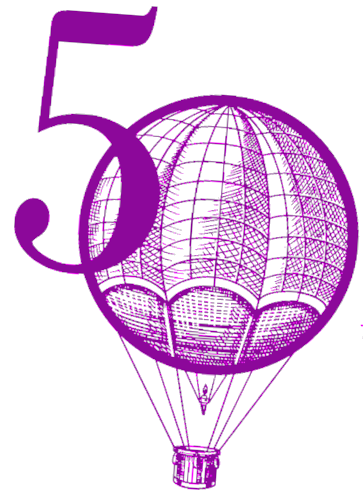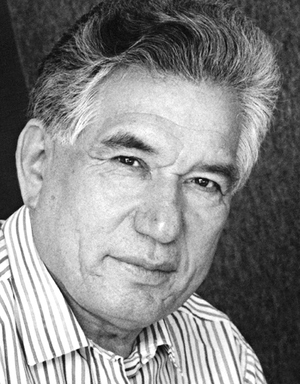Tschingis Aitmatow
Über mein Leben
Notizen über mich
Die eigene Biografie für die Lektüre anderer, für eine Veröffentlichung zu schreiben, ist eine ziemlich schwierige Sache. Was da wohl besser ist: Ausführlich sein Leben schildern oder möglichst kurz? Schreibst du viel, heißt es: Was zieht der sich in die Länge; schreibst du wenig: Wozu schrieb er denn das, wenn er gar nichts zu sagen hat? Am besten ist – gar nicht erst schreiben.
Aber wenn es nun einmal sein muss, will auch ich es versuchen. Ich bin schon über vierzig, da hat sich in meinem Leben wohl etwas getan.
In unserem Ail galt es als unbedingte Pflicht, seine Ahnen bis ins siebte Glied zu kennen. In dieser Hinsicht sind die Alten unerbittlich. Immer wieder prüften sie die Jungen: »Na denn, Batyr, sag an, aus welchem Geschlecht bist du, wer war der Vater deines Vaters? Und dessen Vater? Und seiner? Was für ein Mensch war er, was hat er gemacht, was reden die Leute über ihn?« Und stellt sich heraus, dass der Junge seine Ahnentafel nicht kennt, dringen die Vorwürfe bis zu den Ohren der Eltern. Was ist das nur für ein Vater ohne Sippe und Stamm?, sagt man dann. Worauf achtet der denn? Wie kann da ein Mensch aufwachsen, der seine Vorfahren nicht kennt? Und dergleichen mehr. Hier liegt der Sinn in der Abfolge der Generationen und der gegenseitigen moralischen Verantwortung in der Sippe. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen: Im Roman Der weiße Dampfer habe ich versucht, davon zu sprechen – durch den Mund des Jungen, als er sich mit dem auswärtigen Chauffeur unterhält.
Ich hätte meine Lebensbeschreibung auch mit diesem »feudalistischen Überbleibsel«, wie man das heute zu bezeichnen pflegt, anfangen können. Ich hätte sagen können, dass ich aus der Sippe Scheker stamme. Scheker ist unser Urahn, mein Vater ist Torekul, dessen Vater Altmat und dessen Vater Kimbildl und dessen Vater Kontschudshok. Doch das reicht. Weiter wäre das bloß eine Aufzählung von Namen, über die ich ganz und gar nichts weiß. Und die Leute gibt es schon nicht mehr, die mir über sie etwas erzählen könnten. Mein Ururgroßvater Kontschudshok ist mir nicht dem Namen, sondern dem Beinamen nach überliefert. Ein Leben lang hatte er Tscharyks getragen, Schuhe aus weißgegerbtem Leder, deshalb erhielt er auch den Beinamen Kontschudshok – der Schaftlose, also der ohne Stiefel. Folglich stammen wir von den »Schaftlosen« ab, kein Anlass, sich zu brüsten, aber so war es nun mal …
All dies und was ich noch erzähle, wurde mir übrigens nicht vom Vater mitgeteilt, er kam nicht dazu und musste sich auch um anderes kümmern. Ich verdanke das vor allem meiner Großmutter väterlicherseits, Ajimkan Satankysy, und ihrer Tochter, meiner Tante Karagys Aitmatowa. Erstaunlich, wie nah und ähnlich Mutter und Tochter sein können, im Äußeren wie auch in Charakter und Seelenart. Für mich waren die beiden untrennbar, gleichsam ein und dieselbe Großmutter in zwei Personen, die eine alt, die andere jung. Ich danke dem Schicksal, dass ich diese beiden bemerkenswerten, weisen und schönen Frauen sehen und kennen durfte – sie waren wirklich prächtig … Sie wurden auch meine Erzieherinnen, wo es um alte Bräuche und die Familienchronik ging.
Den Großvater Aitmat habe ich nicht mehr erlebt. Er starb um die Jahre 1918 bis 1920, und ich wurde 1928 geboren (am 12. Dezember). Am Rand unseres Ails Scheker (im Talas-Tal, Kirow-Rayon) liegt noch bis auf den heutigen Tag im Schwemmland des Kurkurëu ein alter, in die Erde gesunkener Mühlstein. Mit jedem Jahr verwittert er mehr und versinkt immer tiefer im Grund. Hier stand einst Großvaters Mühle.
Es heißt, er sei ein geschickter Mann gewesen, konnte nähen und brachte als erster eine Nähmaschine aus der Stadt, daher auch sein Spitzname »Maschinetschl-Altmat«, das heißt Schneider Altmat; Großvater konnte Sättel fertigen, verzinnen und löten, hervorragend auf dem Komus spielen und sogar die arabische Schrift lesen und schreiben. Trotz all seinem Unternehmungsgeist blieb er zeitlebens arm, er kam nie aus den Schulden und Nöten heraus, zeitweise war er sogar ein »Dshatak«, einer, der nicht nomadisiert, weil er kein Vieh hat.
Und da unternahm Großvater den verzweifelten Versuch, der Armut zu entrinnen. Er entschloss sich zum Bau einer Wassermühle, in der Hoffnung, die Einkünfte daraus würden ihn reich machen. Alles, was er und sein Bruder Birimkul besaßen, das gesamte Vermögen von zwei Haushalten, steckten sie in die Mühle. Den ganzen Sommer jenes Jahres hindurch gruben sie mit ihren Familien einen Ableitungsgraben vom Kurkurëti, der sollte der Mühle Wasser zuführen (heute kann man die Spur davon gerade noch erkennen), und gemeinsam errichteten sie Mauern und Dach. So verging ein Jahr, und die Mühle ging in Betrieb. Doch für den Pechvogel Altmat lief es wieder schief. Ein Feuer brach aus, und die Mühle brannte bis auf die Mühlsteine nieder. Endgültig ruiniert, zog Großvater mit dem zwölfjährigen Torekul, meinem Vater, zum Bau des Eisenbahntunnels bei der Station Majmak. Von hier aus kam mein Vater mithilfe der dortigen russischen Behörde an die russische Schule für Einheimische in der Stadt Aulije-Ata, dem heutigen Dshambul.
Ich schreibe das nicht, um eitel daherzuerzählen. Nichts geschieht auf der Welt ohne Grund. Wäre die unglückselige Mühle nicht abgebrannt, wäre Großvater nicht zur Eisenbahn gegangen, und Vater hätte wohl kaum in der Stadt zu lernen begonnen. Dass mein Vater in den ersten Jahren der Revolution bereits eine Bildung hatte (später studierte er noch zweimal in Moskau) und einer der ersten kirgisischen Kommunisten auf leitenden Posten war, dass er sich lebhaft für Politik und Literatur interessierte, dass auch meine Mutter – Nagima Chamsejewna Altmatowa – eine gebildete, durchaus moderne Frau war, all das ermöglichte, dass die beiden mich an die russische Kultur und Sprache heranführten, somit auch an die russische Literatur, die Kinderliteratur, versteht sich.
Andererseits nahm Großmutter mich, ihren Enkel, ständig in die Berge mit zu den Nomadensommerlagern, diese außergewöhnlich bezaubernde und kluge Frau war von allen im Ail geachtet und wurde für mich ein Schatz an Märchen, alten Liedern, Dichtungen und Wahrheiten. Ich sah noch die Nomadenzüge des Volkes, wie sie einst waren. Ein Nomadenzug ist kein bloßer Umzug mit den Herden von einem Ort zum andern, sondern eine große wirtschaftlich-rituelle Prozession. Ein originelles Ausstellen des besten Pferdegeschirrs, der besten Verzierungen, der besten Reitpferde, des besten Packgutes und des besten Teppichs, der auf den Kamelen all dies bedeckte. Eine Schau der besten Sängerinnen unter den Mädchen, die Trauerlieder anstimmten, wenn man einen Ort verließ, wo ein Nahestehender gestorben war, oder auch Wanderlieder. Ich habe diese prachtvollen Schauspiele erlebt, als sie schon am Aussterben waren, beim Obergang zur Sesshaftigkeit sind sie gänzlich verschwunden.
Wahrscheinlich hat mir Großmutter, ohne es selbst zu merken, die Liebe zur Muttersprache eingeimpft. Muttersprache! Was wurde darüber schon alles gesagt! Aber das Wunder der Muttersprache ist nicht zu erklären. Nur ihr trautes, in der Kindheit erfasstes und begriffenes Wort kann einen mit der Poesie erfüllen, die aus der Volkserfahrung stammt, sie kann im Menschen die ersten Quellen des Nationalstolzes wecken und den ästhetischen Genuss an der Vielfalt und Vieldeutigkeit der Sprache der Vorfahren vermitteln. Die Kindheit ist nicht nur eine herrliche Zeit, die Kindheit ist der Zellkern der künftigen Menschenpersönlichkeit. In der Kindheit wird das echte Wissen um die Muttersprache angelegt, da kommt das Empfinden für Zugehörigkeit auf – zu Menschen und Natur seiner Umwelt, zu einer bestimmten Kultur.
Ich kann, zumindest aufgrund meiner eigenen Erfahrung, sagen, dass sich ein Mensch in der Kindheit auf organische Weise zwei Sprachen aneignen kann, die ihm parallel zukommen, vielleicht sogar mehr als zwei, falls diese Sprachen von den ersten Jahren an in gleichem Maß einwirken. Für mich ist die russische Sprache nicht minder vertraut wie die kirgisische, von Kindheit an vertraut, und dies fürs ganze Leben.
Fünf Jahre war ich, als ich mich zum ersten Mal in der Rolle eines Dolmetschers befand, und ein Stück Siedfleisch war mein erstes »Honorar«. Es geschah im Sommerlager in den Bergen, wo ich wie üblich mit Großmutter war. In jenen Jahren waren die Kolchosen erst im Entstehen, sie begannen gerade, sich zu konsolidieren. In jenem Sommer hatte sich in unserem Dshajloo ein Unglück ereignet. Der Zuchthengst, den die Kolchose kurz zuvor gekauft hatte, verendete plötzlich. Am helllichten Tag brach er mit aufgedunsenem Wanst zusammen und gab den Geist auf. Die Pferdehirten waren tief bestürzt, der Hengst war wertvoll, ein Dongestütler, den man aus dem fernen Russland hergebracht hatte. Man schickte einen Boten zum Kolchos, von dort einen weiteren zum Rayon. Und nach zwei Tagen kam zu uns ein russischer Mensch. Hochgewachsen, mit rotem Bart und blauen Augen, in schwarzer Lederjacke, an seiner Seite hing eine Feldtasche. Ich habe ihn mir sehr gut eingeprägt. Er verstand kein Wörtchen Kirgisisch, und die unsrigen konnten kein Wort Russisch. Man musste eine Obduktion vornehmen, die Todesumstände des Tieres klären und ein Protokoll darüber aufsetzen. Die Pferdehirten beschlossen, ohne lang nachzudenken, dass ich der Dolmetscher sein musste. Ich aber stand derweil inmitten einer Schar Kinder, wir beäugten den Ankömmling.
»Komm«, sagte der Hirte zu mir und nahm mich bei der Hand. »Dieser Mann kennt unsere Sprache nicht, übersetz du, was er spricht, und was wir sagen, das wirst du ihm sagen.«
Ich genierte mich, war erschreckt, riss mich los und rannte zur Großmutter in die Jurte. Hinter mir drein, von Neugier geplagt, alle meine Freunde. Kurz danach kommt wieder jener Mann und beschwert sich über mich. Großmutter war sonst immer zärtlich, aber dieses Mal verfinsterte sich ihre Miene.
»Warum willst du mit dem Zugereisten nicht reden, die Großen bitten dich sogar darum, kannst du vielleicht kein Russisch?«
Ich schwieg. Hinter der Jurte hielten sich die Kinder versteckt – was würde nun passieren?
»Was ist mit dir, schämst du dich, russisch zu sprechen, oder schämst du dich der eigenen Sprache? Alle Sprachen sind von Gott gegeben, also zier dich nicht, gehn wir!« Sie fasste meine Hand und führte mich hin. Die Kinder wieder hinter uns her.
In der Jurte, wo zu Ehren des Gastes bereits ein frischer Hammel garte, drängte sich viel Volk. Sie tranken Kumys. Der zugereiste Veterinär saß mit den Aksakalen zusammen.
Er lächelte und winkte mich zu sich. »Komm her, Junge, wie heißt du denn?«
Ich murmelte still vor mich hin.
Er streichelte mich. »Frag sie, warum dieser Hengst verendet ist.« Er nahm sich Papier zum Schreiben.
Erwartungsvoll verstummten alle, aber ich zog mich in mein Schneckenhaus zurück und brachte kein Wort heraus. Großmutter saß bestürzt da. Da nahm mich ein alter Mann, ein Verwandter von uns, auf den Schoß. Er drückte mich an sich und sprach mir vertraulich und ernst ins Ohr: »Dieser Mann kennt deinen Vater. Was soll er ihm jetzt von uns erzählen? Soll er ihm sagen, was für ein schlechter Sohn ihm bei den Kirgisen heranwächst?« Und dann erklärte er laut: »Jetzt wird er sprechen. Sag unserem Gast, dass dieser Ort Uu-Sas heißt …«
»Onkel«, begann ich zaghaft, »dieser Ort heißt Uu-Sas, die giftige Wiese.« Und dann fasste ich mir ein Herz, ich sah, wie sich Großmutter und dieser Zugereiste freuten und auch alle anderen in der Jurte. Und fürs ganze Leben prägte sich mir diese Synchronübersetzung des Gesprächs ein – Wort für Wort, in beiden Sprachen. Der Hengst war wohl an dem giftigen Gras verendet. Auf die Frage, warum die anderen Pferde dieses Gras nicht fräßen, erläuterten unsere Pferdehirten, die einheimischen Gäule rührten es nicht an, sie wüssten, dass es ungenießbar sei. Genau so habe ich alles übersetzt.
Der Zugereiste lobte mich, die Aksakale gaben mir ein ganzes Stück heißes, duftendes Siedfleisch, ich sprang mit triumphierendem Blick aus der Jurte hinaus. Augenblicklich hatten mich die Kinder umringt. »Uch, toll!«, riefen sie begeistert aus. »Du sprudelst pausenlos auf Russisch daher, wie das Wasser im Fluss!« In Wirklichkeit hatte ich stockend gesprochen, aber den Kindern passte es eben, sich das so vorzustellen, wie sie es wollten. Auf der Stelle aßen wir das Fleisch auf und rannten spielen.
Lohnt es sich denn, in einer literarischen Biografie solche Dinge zu erwähnen? Ich meine schon. Man sollte mit den ersten Erinnerungen eines Menschen beginnen, wann und wie das gewesen ist. Manche erinnern sich zurück bis ins dritte Lebensjahr, andere können kaum das zehnte im Gedächtnis behalten. Ich bin überzeugt, dass all das viel zu bedeuten hat. In meiner Kindheit hat sich also diese Geschichte zugetragen. Großmutter war mit mir sehr zufrieden und erzählte noch lange danach ihren Bekannten von diesem Geschehnis, das ihr Herz mit Stolz erfüllte.
Sie verschönte meine Kindheit mit Märchen, mit Liedern und Begegnungen, mit Märchenerzählern und den Akyns, unseren Volkssängern, überallhin nahm sie mich mit. Sei es zu Besuchen oder zu einem Dshejentek, der Feier eines Neugeborenen, zu Beerdigungen und Hochzeiten. Sie hat mir oft ihre Träume erzählt. Diese Träume waren dermaßen interessant, dass sie nur ein Nickerchen zu machen brauchte und ich sie auf der Stelle weckte und aufforderte, mir zu erzählen, was sie im Traum gesehen habe. Kleine, kurze Träume befriedigten mich ganz und gar nicht. Da ging sie zu den Nachbarn, um sich »einen Traum auszuleihen«. Erst später wurde mir klar: Sie hatte sie sich einfach für mich ausgedacht.
Großmutter ist bald gestorben. Nun lebte ich ständig zu Haus, in der Stadt. Und ich ging dann zur Schule. Aber innert zwei Jahren verschlug es mich wieder in meinen heimatlichen Ail. Dieses Mal für lange Zeit und unter bedrückenden Umständen.
Im Jahr 1937 wurde mein Vater, Parteifunktionär und Hörer am Moskauer Institut der Roten Professur, von der Repression getroffen. Unsere Familie siedelte in den Ail um. Damals begann für mich die wahre Schule des Lebens, mit all ihren Verwicklungen.
In jener schweren Zeit hat uns Vaters Schwester Karagys-apa aufgenommen. Wie gut, dass wir sie hatten. Sie hat mir die Großmutter ersetzt. Wie ihre eigene Mutter war sie sehr geschickt, konnte Märchen erzählen und alte Lieder singen, im Ail genoss sie ebenfalls Achtung und Ansehen. Meine Mutter war schwer krank in den Ail gekommen, sie krankte noch lange, lange Jahre, aber wir waren vier Kinder, ich war der Älteste.
Unsere Lage war sehr bedrückend, aber Karagys-apa hat uns die Augen dafür geöffnet, dass der Mensch nicht verloren ist, wenn er sich inmitten seines Volkes befindet, so schwer seine Not auch sein mag. Nicht nur unsere Stammesbrüder, die Leute von Scheker – dieses »feudalistische Relikt« hat uns damals unschätzbare Dienste geleistet –, sondern auch die Nachbarn und bislang völlig Unbekannte haben uns nicht alleingelassen in der Not, sie wandten sich nicht ab von uns. Sie teilten mit uns, wo sie nur konnten – Brot, Heizmaterial, Kartoffeln und sogar warme Kleider.
Als einmal mein Bruder Ilgis und ich Reisig zum Heizen zusammentrugen – Ilgis ist jetzt Direktor des Instituts für Physik und Mechanik des Bergbaus an der Kirgisischen Akademie der Wissenschaften der Kirgisischen SSR –, näherte sich uns vom Weg ein Reiter, gut gekleidet und auf einem schönen Pferd. »Wessen Söhne seid ihr?« fragte er.
Unsere Karagys-apa hat uns immer wieder beigebracht, dass man in solchen Fällen den Menschen in die Augen blicken und den Namen seines Vaters sagen musste. Meinen Bruder und mich hat es sehr mitgenommen, was damals über unseren Vater geschrieben wurde, aber sie, Karagys-apa, schämte sich nicht unserer Schmach. Irgendwie hat diese Frau, die nicht lesen und schreiben konnte, begriffen, dass das alles erlogen war und nicht stimmen konnte. Ich habe schon damals Bücher über Kundschafter der Tscheka gelesen und insgeheim davon geträumt, man würde mich losschicken, einen Spion zu jagen, ich würde ihn schnappen und dabei zugrunde gehen, damit ich vor der Sowjetmacht auf die Weise die Unschuld meines Vaters unter Beweis stellen könnte.
Dieser Mann war also vom Weg hergeritten und hatte uns gefragt, wem wir gehörten. Und wenn es auch qualvoll war, habe ich, ohne die Augen zu senken, den Namen genannt. »Was hast du da für ein Buch?«, wollte er wissen.
Das war ein Schulbuch, wie ich mich entsinne, ein Lehrbuch für Geografie, das ich hinterm Gürtel eingeklemmt hatte. Er schaute es sich an und fragte: »Wollt ihr in die Schule gehen?«
Und ob! Wir nickten und bissen uns auf die Lippen, um nicht loszuheulen. »Schön, ihr könnt in die Schule!« Dann ritt er davon.
Schon nach einer Woche besuchten wir die Schule. Wie es sich herausstellte, war das einer unserer Lehrer gewesen, Tynalijew Üsübaly. Ich kam in die Klasse der Lehrerin Inkamal Dsholowaja, sie hat mir in jenen Tagen viel Mitgefühl entgegengebracht.
Ich habe früh zu arbeiten begonnen, mit zehn Jahren erfuhr ich, was Landarbeit heißt.
Nach einem Jahr zogen wir ins Rayonzentrum um, in das russische Dorf Kirowskoje. Mutter wurde dort als Buchhalterin eingestellt. Erneut besuchte ich eine russische Schule. Das Leben hatte sich ein wenig normalisiert, und da brach der Krieg aus.
Im Jahr 1942 musste ich die Schule aufgeben, uns alle zur Kriegszeit lernen zu lassen, war für Mutter zu viel.
Und so kam ich wieder heim nach Scheker, das von den Lasten des Krieges erdrückt wurde und abgewirtschaftet war. Man setzte mich als Sekretär des Dorfsowjets ein, unter den Halbwüchsigen war ich der bestausgebildete, ein anderer ließ sich für die Arbeit nicht finden. Ich war vierzehn Jahre.
Aber wo Unglück, ist auch Glück, wie man so sagt. Wenn ich in der Kindheit das Leben von seiner poetischen und hellen Seite kennenlernte, zeigte es sich mir nun von seiner harten, nackten, leidvollen und heldenhaften Seite. Ich sah mein Volk in seiner anderen Verfassung – im Augenblick der größten Gefahr für die Heimat, in der äußersten Anspannung seiner geistigen und physischen Kräfte. Ich war gezwungen und verpflichtet, das zu sehen, ich kannte jede Familie im Bereich des Dorfsowjets, kannte jedes Mitglied einer Familie sowie die ausnahmslos karge Ausstattung aller Höfe. Ich lernte das Leben von seinen verschiedenen Seiten und in unterschiedlichen Äußerungen kennen.
Sodann arbeitete ich während der Kriegsjahre als Finanzbeamter der Rayonverwaltung und trieb von der Bevölkerung Steuern ein. Hätte ich vorher gewusst, wie schwierig das in Zeiten von Krieg und Hunger ist! Das war so qualvoll für mich, dass ich nach einem Jahr, im August 1944, diese Arbeit eigenmächtig hinwarf und dafür beinahe vor Gericht kam. Ich war dann als Rechnungsführer bei einer Traktoristenbrigade zur Getreideernte.
Der Krieg dauerte an, und das Leben erschloss mir, dem Jüngling, immer mehr und neue Seiten im Dasein des Volkes. All dies hat viel später, so gut es mir gelang, in den Novellen Aug in Auge, Der Weg des Schnitters, teilweise auch in Dshamilja und Du meine Pappel im roten Kopftuch Gestalt angenommen.
Im Jahr 1946, nach Abschluss der achten Klasse, immatrikulierte ich mich am Zootechnikum von Dshambul. Das ganze Praktikum von 1947 bis 1948 verbrachte ich daheim im Ail und konnte somit wie ein Außenstehender die Nachkriegsveränderungen im Leben der mir nahestehenden Menschen beobachten.
Nach Abschluss des Technikums im selben Jahr wurde ich als Bestabsolvent im Kirgisischen Landwirtschaftsinstitut angenommen, das ich übrigens auch mit Auszeichnung abschloss.
Die Literatur liebe ich seit der Kindheit, in der Schule verfasste ich gern Aufsätze zu Themen freier Wahl, und schon während der Institutsjahre war mir klar geworden, dass mich die schöngeistige Literatur immer stärker in ihren Bann zog. In den Vorbildern aus der Literatur jener Zeit suchte ich Antworten auf die Fragen, die mich bewegten. Ich wünschte mir sehr, dass kraftvolle, eindringliche Werke über den Krieg und die Ruhmestaten des Volkes geschrieben würden. In der kirgisischen Literatur war damals das Kriegsthema noch nicht tiefgründig erfasst. Ich wünschte mir, dass auch die kirgisische Leserschaft die Möglichkeit erhielt, die besten Bücher über den Krieg kennenzulernen. Von diesem Gefühl getrieben, machte ich mich daran, den Sohn des Regiments und die Weiße Birke auf eigenes Risiko zu übersetzen, ohne die geringste Vorstellung, was schöngeistiges Übersetzen und die Herausgabe eines Buches bedeuten. Als ich meine Übersetzungen zum Verlag brachte, wurde mir gesagt, dass diese Bücher längst übersetzt seien und demnächst herauskämen.
Mich hat das damals ziemlich getroffen, aber ausgerechnet dies war der Beginn meiner literarischen Arbeit. Schon als Student schrieb ich Glossen, Artikel und Skizzen für Zeitungen.
Nach dem Institut arbeitete ich als Zootechniker. In jenen Jahren verfasste ich schon Erzählungen. Im Jahr 1956 begab ich mich nach Moskau und nahm an höheren Literaturkursen teil. Diese zwei Studienjahre haben mir, dem ehemaligen Zootechniker, außerordentlich viel vermittelt. Das betraf nicht nur die geisteswissenschaftliche und theoretische Ausbildung, sondern auch die unmittelbare Praxis – unsere Seminare und Diskussionen in den Oberkursen waren eine gute Schule fürs Schöpferische. Und ich selbst bemühte mich darum, am Besten des Moskauer Kulturlebens teilzuhaben, in der Literatur wie im Theater. Nach diesen Lehrgängen arbeitete ich als Chefredakteur bei der Zeitschrift Literaturnyi Kirgisstan, danach als Korrespondent der Prawda in Kirgisien, auch dies erweiterte den Kreis meiner Beobachtungen und ließ mich das Leben besser kennenlernen.
Ein Schriftsteller muss natürlich von Natur aus über die Fähigkeit verfügen, künstlerisch zu denken, aber seine Begabung und Persönlichkeit formen sich in Verbindung mit einem bestimmten Gesellschaftsmilieu, der geistigen Erfahrung und den Kulturtraditionen dieser Umgebung, mit deren Weltanschauung und politischem Aufbau. Für uns ist diese Welt die sowjetische Gesellschaft, die sozialistische Ordnung, die kommunistische Weltanschauung. Daraus entspringt die Orientierung im Schaffen von sowjetischen Schriftstellern.
Man muss nicht speziell betonen, dass 1963 die Verleihung des Leninpreises für das Buch Erzählungen der Berge und Steppen ein freudiges, ungeheures Ereignis in meinem Leben war. Ich bin dem Volk dankbar für diese höchste Ehre.
Niemand wird zum Schriftsteller allein aus sich selbst heraus: Die Erfahrung der Vorausgegangenen fließt ein in die Schöpferwelt des Künstlers, lange bevor er in sich literarische Neigungen erkennt. Freilich ist es bei Weitem nicht allen von uns gegeben, auf dem schwierigen Weg der Kunst Neues zu entdecken und zu vollenden. Das hängt dann schon von der Begabung und der Weite der Lebensanschauung ab. Oftmals treten wir auf der Stelle, die bereits die Vorgänger erreicht hatten, häufig gehen wir rückwärts, was Meisterschaft, Gedankentiefe, Gestaltungskraft und Bildhaftigkeit betrifft. Offenbar vollzieht sich so der literarische Entwicklungsprozess: Verwickelt, langwierig, ungleichmäßig, mitunter schwer erklärbar.
Über die Schicksale der Literatur und den eigenen schöpferischen Weg muss man oft und aus verschiedenen Anlässen nachdenken. Da ich von mir spreche, möchte ich mich hier über den Weißen Dampfer äußern, der unter den Lesern diverse Auseinandersetzungen hervorgerufen hat. Kontroversen gehören dazu, die Literatur hat sie nötig. Aber was mich hier die Ohren spitzen ließ, war, so paradox das klingt, die Gefahr einer äußerst wohlwollenden, meiner Meinung nach sehr ehrlichen Kritik. Manche Leser, denen etwa Dshamilja, Der erste Lehrer, Der Weg des Schnitters und andere Werke gefallen haben, möchten, ausgehend von ihren Vorstellungen über die Kunst, dass ich auch künftig nur in diesem Geist schreibe. Ich denke nicht daran, mich selbst zu verleugnen, leugne auch nicht die Bedeutung dessen, was vor Abschied von Gülsary und Der weiße Dampfer entstand, aber ich habe auch nicht vor, darauf festzusitzen, was für mich eine bereits zurückgelegte Etappe darstellt. Die Literatur muss selbstlos ihr Kreuz tragen und in die Verwicklungen des Lebens eindringen, damit der Mensch das Gute, Beste und Würdigste in sich, in den Menschen und der Gesellschaft kennt, liebt und darum bangt. Darin sehe ich die wahre Bestimmung der Kunst. Und mir scheint – das ist meine Überzeugung –, dass es auf immer so bleiben muss, da ja der Mensch in der Kunst auf der Suche, ist und seine besten Bestrebungen bestätigt und all das abgelehnt haben will, was das Böse ausmacht und seinen sozialen und sittlichen Idealen widerspricht. Das geht nicht ab ohne Kämpfe, Zweifel und Hoffnungen. Und so wird es wohl ewig bleiben. Daher hat die Kunst dem Menschen immer und ewig über die Kompliziertheit und Schönheit des Lebens zu erzählen.
Ich weiß nicht, wie sich mein weiteres künstlerisches Schicksal fügen wird und ob ich etwas Interessantes werde machen können. Wie heißt es doch: Warten wirs ab, wir werden sehen.
(Die erste Autobiografie, geschrieben in Frunse 1971, veröffentlicht in Sowjetskije pisateli – Sowjetische Schriftsteller, Autobiografien, Band 4, Moskau 1972)
Schnee auf dem Manas-Ata
Nach Scheker fahre ich ziemlich oft: zwei-, dreimal im Jahr. Zu verschiedenen Anlässen wie Hochzeiten und Beerdigungen. Gern würde ich auch meine Söhne, typische Städter, bewegen, engen Kontakt zu unseren Landsleuten aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Wies scheint, ändern sich die Zeiten.
Unser Scheker ist ein großer, fest verwurzelter Ail mit reichlich dreihundert Wirtschaften. Wann ich auch hinkomme, entdecke ich hier und da neue Häuser unter neuen Dächern. Es werden immer mehr Familienhöfe. Der Ail wächst. Und er ist unübersehbar, liegt, wie man bei uns sagt, »an des Wassers Kopf«, am Fuß des Talas-Gebirges, des Pik Manas – genau unterm Sattel von dessen doppelköpfigem Gipfel. Diesen hochragenden Berg pflegte der Recke Manas auf seinem Ross zu erstürmen, um die Gegend ringsum zu betrachten – ob nicht Feinde im Anzug wären. (Man kann sich unschwer vorstellen, welch riesigen Raum Manas von jener Höhe überschaute. Es sind wahrhaft epische Maßstäbe! So wollte vor alten Zeiten das Volk seinen Sohn und Helden Manas sehen.) Wie dem auch sei, von dort, unterm ewigen Schnee des Manas hervor, kommt der ungestüme und eiskalte Kukurëu ins Tal, bringt Wasser und also auch Leben allem auf Erden …
Ich bin immer bewegt, wenn ich mich Scheker nähere und bereits von fern – funkelnd in unzugänglicher himmlischer Höhe – die bläulichweißen Schneefelder des Manas erblicke. Überlässt man sich diesem Bild, schaut lange Zeit nur auf diesen Gipfel, auf den Himmel, dann scheint die Zeit stehenzubleiben. Es schwindet das Gefühl für Vergangenes. Nein, denke ich, nichts ist geschehen, nichts hat sich verändert, auf der Welt ist alles noch so wie vor zehn, zwanzig, ja vielleicht hundert und tausend Jahren. Der Manas steht da wie einst. Nach wie vor ziehen Wolken über ihn hin, dieselben Wolken. Und ich bin immer noch der Junge von einst, der des Morgens aus dem Haus läuft, diesen Berg überm Ail sieht und sich darüber freut. Doch leider, sich in Träumen verlieren kann man nur für ein, zwei Minuten …
Diesmal war ich bei meiner Fahrt nach Scheker aufgewühlter als sonst. Das hatte seinen Grund. Die Redaktion des Ogonjok hatte mich um einen Report über das Leben meiner Landsleute im Krieg gebeten. Zuerst hegte ich Zweifel: Was gibt es da schon groß zu berichten, Hinterland bleibt Hinterland. Krieg – das sind die Front, die Schlachten, dann erst kommt alles übrige. Diese Zweifel begleiteten mich den ganzen Weg. Als ich mich jedoch dem Ail näherte, die ewigen Schneefelder des Manas vor Augen, erinnerte ich mich an vieles.
Meine Kindheit, alle Kriegs- und Nachkriegsjahre hatte ich hier verbracht, in dieser Gegend, dem damaligen Ailsowjet Scheker. Ebenjene Zeit und die Menschen jener Tage gingen mir nun durch den Sinn. Es waren ganz normale Leute – Werktätige, Bauern, Aktivisten, wie man sie in jedem Kolchos oder Sowchos antrifft. Wenn ich heute an den Krieg denke, sehe ich jeden gewissermaßen in Großaufnahme, in greller und voller Beleuchtung durch die Kriegsereignisse. An die Kundgebungen der ersten Kriegstage erinnere ich mich. Die gemeinschaftliche Verantwortung für das Schicksal des Landes wurde zur persönlichen. Unmittelbar von den Kundgebungen verließen Freiwilligenkolonnen das Kreiszentrum in Richtung Front. Wie ich es heute sehe, fand ein jeder, ob groß oder klein, an der Front oder im Hinterland seinen historischen Platz in diesem grandiosen Volkskampf … Ja, den historischen Platz. Anders kann man es nicht nennen.
Und daher sind es keine bloßen Redensarten, wenn wir sagen: »vor dem Krieg«, »nach dem Krieg«, »im Krieg«. Für mich liegt mehr in diesen Worten als die Chronologie der Ereignisse, für mich spricht aus ihnen eine Zeit bitterer Lebenserkenntnis, eine Zeit, in der unsere Gesellschaft Erfahrungen von universellem Rang erwarb. Denn der Krieg unterteilte nicht nur als globaler historischer Markstein die Menschheitsentwicklung im zwanzigsten Jahrhundert in ihre Vorkriegs- und ihre Nachkriegsperiode, sondern wurde auch zum Schicksal eines jeden, der ihn erlebte, zum Kriterium seiner Handlungen und sittlichen Werte. Der Krieg griff buchstäblich in jedermanns Leben ein, ich kenne keinen, der sich ihm so oder so hätte entziehen können. Wer das versuchte, geriet unvermeidlich mit dem Volk in Konflikt, denn wo es um die Existenz des ganzen Volkes ging, durfte es keine Ausnahme geben. (Diesem Thema widmete ich denn auch meine erste kleine Novelle, Aug in Auge.) Einem jeden präsentierte der Krieg auf seinem Lebensweg die größte Rechnung der Epoche …
Hier schulde ich schon Auskunft über die eigenen Erfahrungen. Bei Kriegsausbruch war ich dreizehn Jahre alt. Da also begann für meine Generation die Entdeckung der großen Welt. Jetzt kann ich es selbst kaum fassen, doch schon mit vierzehn Jahren arbeitete ich als Sekretär des Ailsowjets. Mit vierzehn Jahren musste ich recht komplizierte gesellschaftliche und administrative Fragen entscheiden, die auf verschiedenste Weise – noch dazu unter Kriegsbedingungen! – das Leben eines großen Dorfes betrafen. Doch damals war das gar nicht außergewöhnlich. Jungen, die 1941 die siebente Klasse beendet hatten, unterrichteten bereits in unseren Klassen – so Païsbek Mombekow (ein Leben lang, dreiunddreißig Jahre, war der Mann dann als Lehrer tätig!) und der heutige Direktor der Mittelschule von Scheker, Sejtaly Bekmambetow. Nach dem Krieg erst konnten sie studieren. Mein Bruder Ilgis, heute Direktor des Instituts für Gesteinsphysik und -mechanik bei der Kirgisischen Akademie der Wissenschaften, ist drei Jahre jünger als ich. Er ging damals zur Schule und arbeitete zugleich als Briefträger. Den ganzen Krieg über. Ich bin stolz auf ihn. Ein prächtiger und gewissenhafter Briefträger war er in jener bitteren Zeit. Der barfüßige, schmächtige Elfjährige – so einen würde man heutzutage kaum allein in eine nahe Straße gehen lassen – lief nach Soldatenbriefen und Zeitungen, die er dann den Leuten bei der Feldarbeit vorlas, viele Kilometer weit, über einen Fluss ins Nachbardorf, wo die Post war. Fünfzehn Jahre war er alt, als er – von der Vollversammlung des Kolchos Dshijde vorgeschlagen – die Medaille »Für hervorragende Arbeit im Großen Vaterländischen Krieg 1941–1945« erhielt. Er hat sie verdient. Das kann ich bestätigen. Doch nicht darum geht es. Im Grunde verdanken wir beide, wie viele Halbwüchsige der Kriegsjahre, unsere besten Eigenschaften älteren Menschen, die uns mit Wort und Tat durch ihr Beispiel erzogen.
Ich weiß noch, im Winter 1942 wurde ich einmal vom Boten des Dorfsowjets, Kenesch, aus dem Haus gerufen. »Steig zu mir aufs Pferd, Söhnchen«, sagte er. »Die Obrigkeit will es. Sicher gehts um etwas Wichtiges.« Er nahm den Fuß aus dem Steigbügel, zog mich auf die Kruppe des Pferdes, und wir beide ritten los. Er saß vorn, ich hinten.
Er war gleichfalls eine interessante Persönlichkeit in unserem Ail. Eigentlich hieß er Ibraïm. Doch weit und breit nannten ihn alle Kenesch. »Kenesch« heißt »Sowjet« und steht für »Sowjetmacht«. Er, der Ärmste der Armen, hatte als Erster im Ail seine Stimme laut für die Erretterin der Armen, die Sowjetmacht, erhoben, war unser erster Landarbeiterdeputierter in den Jahren nach der Revolution. Ebendas zeichnete diesen lese- und schreibunkundigen Landarbeiter aus: Sein Leben lang agierte er auf allen großen und kleinen Versammlungen für die Sowjetmacht. Und stets versicherte er dabei, für sich persönlich keinerlei Vorteil zu suchen. »Für mich ein Stück Brot und fürs Pferd ein Bündel Heu – mehr brauch ich nicht. Für die Sowjetmacht aber werde ich Tag und Nacht arbeiten, bis ich aus dem Sattel falle.« Als es darum ging, eine Staatsanleihe zu zeichnen, gab er seine letzte Ziege weg. So arbeitete er bis zum Ende seiner Tage als Bote und freiwilliger Agitator und starb, man kann schon sagen, tatsächlich im Sattel. An den Hängen des Manas gedenken die Menschen seiner bis zum heutigen Tag. Und bis zum heutigen Tag voller Staunen. In den Kriegsjahren war Kenesch bereits alt, doch seine aktive, leidenschaftliche Natur ließ sich nicht unterkriegen – einige Male war ich Zeuge seiner »spontanen« Agitationsreden auf Versammlungen. Man spürte die Erfahrung des Landarbeiterdeputierten, er sprach mit innerer Anteilnahme, seine Worte kamen von Herzen, zündeten …
Dieser Mann also brachte mich in den Dorfsowjet. In dem kalten, ungeheizten Raum mit dem Erdfußboden und den kleinen Fenstern aus Glasbruchstücken saßen drei Männer. Der hochgewachsene Graubart im Pelz, ein älterer Hirt aus Artschagul, dem Nachbar-Ail jenseits des Flusses, war Kabylbek Turdubajew – Vorsitzender unseres Dorfsowjets, seit der frühere an die Front gegangen war. Die beiden anderen in Soldatenmänteln waren verwundete Frontsoldaten: der Kolchosvorsitzende Alischer Aidarow, erst kürzlich aus dem Krieg heimgekommen, noch mit verbundenem Arm, und der Sekretär des Dorfsowjets, Kaly Nukejew, mit Krücken, die an der Wand lehnten. (Alle drei Veteranen sind noch am Leben: Kabylbek Turdubajew ist Rentner und verdienter Kolchosbauer, Alischer Aidarow Agronom beim Tabakanbau, Kaly Nukejew Vorsitzender des benachbarten Dorfsowjets Kök-Sai.)
»Die Schule musst du einstweilen verlassen«, sagte mir damals Turdubajew. »Später holst du alles nach. Wenn der Krieg vorbei ist. Denn Kaly wird Brigadier …« Er nickte zu Nukejew hin. »Mit seinen Krücken hätte er es natürlich viel leichter als Sekretär. Aber ohne Brigadier gehts nicht im Kolchos. Das verstehst du doch selber. Und sonst kann das keiner. Mir aber fehlt es an Schulwissen. Mein Lebtag hatte ich nur mit Vieh zu tun. Ich brauch einen gescheiten Gehilfen. Da haben wir also beschlossen, du machst diese Arbeit …«
So wurde ich Sekretär des Dorfsowjets. Artschagul, der Ail jenseits des Flusses, gehörte auch noch zu uns. Zwei große Aile, die unruhige Kriegszeit – der Vorsitzende aber kam von der Schafherde und der Sekretär von der Schulbank. So war die Lage. Das Leben indessen nahm seinen Lauf, stellte uns vor Aufgaben, die keinen Aufschub duldeten. Arbeit gab es zur Genüge. Und mit meinem Wissen war es auch nicht weit her. So verfügte das Kreisexekutivkomitee in einem Papier für das Territorium des Dorfsowjets eine »Malleïnisierung« – das war, wie sich später herausstellte, ein veterinärmedizinischer Terminus, und er bedeutete die Spezialbehandlung des Pferdebestandes mit irgendwelchen Präparaten. Ich aber sagte Turdubajew, uns erwarte eine »Mobilisierung« aller Pferde. Er wurde ganz grau im Gesicht. »Und was machen wir hier in den Kolchosen ohne Zugtiere?« Also begaben wir uns auf schnellstem Weg ins Kreiszentrum, ins Dorf Kirowskoje, vierzig Kilometer weit. Um Mitternacht ritten wir los. Trafen schließlich ein, voller Unruhe. Doch dort erklärte man uns alles. Es war einfach ein Missverständnis. Wie wir dann aus dem Kreisexekutivkomitee treten und die Pferde besteigen wollen – ich hatte ein großes Tier erwischt, war aber selber klein, trug obendrein Pelzmantel und Pelzmütze und war gegürtet, denn es war Winter –, da bekomme ich doch den Fuß nicht in den Steigbügel; es war einfach nichts zu machen. Wir mussten aber noch schleunigst zur Bank. Während ich vergeblich versuchte, aufs Pferd zu klettern, hob mich Turdubajew hoch – er war ein kräftiger Mann –, und schon saß ich im Sattel. Auch noch diese Schmach! Was war ich für ein Dorfsowjetsekretär, wenn man mich wie ein kleines Kind in den Sattel setzte!
»Ich mach die Arbeit nicht länger!«, erklärte ich ziemlich schroff.
»Es hat ja keiner gesehen«, beschwichtigte mich Turdubajew. »Und von der Arbeit kommst du nicht los. Du musst eben noch lernen. Sowie der Krieg aus ist, gehst du wieder in die Schule. Vorwärts!«
Heute, nach vielen Jahren, danke ich dem Schicksal, dass es mich sozusagen von Kind auf mit interessanten, würdigen Menschen zusammengeführt hat. Einer von ihnen war mein Dorfsowjetvorsitzender, der weise Aksakal Turdubajew, ein ehemaliger Hirte. Anderthalb Jahre darauf, als Leute mit Schulbildung aufgetaucht waren, verwundete Offiziere, kehrte er wieder zu seinem ursprünglichen Beruf zurück. Viel später einmal trafen wir uns beim Totenmahl für einen uns nahestehenden Menschen, kamen ins Gespräch und erinnerten uns natürlich an die gemeinsame Arbeit im Dorfsowjet. Ich dachte, der alte Mann würde – wie bei solchen Gelegenheiten üblich – darüber scherzen, dass damals, da es nichts anderes gab, eine Schnepfe für eine Ente herhalten musste. Aber nein, er unterhielt sich durchaus ernst. »Oft überlege ich noch«, sagte er, »ob wir damals alles so gemacht haben, wie es nötig gewesen wäre.«
Nötig aber war viel in dieser schweren, harten Zeit. Unentwegt wurden Menschen mobilisiert. An die Front, zum Arbeitseinsatz, für Bergwerke, zur Holzbeschaffung und sogar zur Arbeit am Tschu-Kanal, der in jenen Jahren weitergebaut wurde. Wir beschränkten uns nicht darauf, den Leuten ihre Gestellungsbefehle auszuhändigen und alles amtlich zu registrieren. Turdubajew hielt es für seine Pflicht, mit jedem Einberufenen und mit dessen Familie zu reden, da zu überzeugen, dort mit Rat und Tat zu helfen, stets gab er ihnen ein gutes Wort mit auf den Weg, fuhr oft selbst mit ihnen ins Kreiszentrum und ins Militärkommissariat, blieb an ihrer Seite bis zum Abtransport. Einige Male übertrug er diese Aufgabe auch mir, obwohl ich dafür kaum die geeignete Person war. Wie sehr ich mich auch bemühte, gesetzt zu wirken, Junge bleibt Junge.
Einmal geschah Folgendes. Ein Hirte, der zum Arbeitseinsatz einberufen war, erschien nicht zum festgesetzten Termin im Dorfsowjet, um ins Kreiszentrum verabschiedet zu werden. Den Boten schickte er unverrichteter Dinge weg. Ich musste zu ihm hin. Der Mann empfing mich auf der Schwelle seines Hauses, wütend und gereizt. Ehrlich gesagt, er hatte recht. Das ganze Jahr über war er mit einer Schafherde herumgezogen, hatte mit Frau und Kindern nomadisiert. Vier Hirten waren dafür vorgesehen, er hatte mit seiner Frau allein gearbeitet. Für seine Arbeitseinheiten hatte er nichts bekommen. Jetzt wurde er einberufen. Von den Bergen war er in sein unbewohntes, verlassenes Haus im Ail heruntergestiegen. Dort aber war alles wie leergefegt, es gab keinerlei Vorräte, weder Heizmaterial noch Kleidung, noch Futter für die Kuh.
»Wie kann ich losfahren und sie im Stich lassen!«, sagte er und wies auf die kleinen Kinder und seine kranke Frau, die, mit einem Pelz zugedeckt, in einer Ecke lag.
Ich wusste nicht weiter. Doch mir war klar: Gesetz ist Gesetz, man musste es erfüllen. »Fahren Sie, wir kümmern uns schon«, versicherte ich ihm aufrichtig, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, wie und womit ich dieser Familie helfen könnte. Der Hirte lächelte traurig. »Du willst dich kümmern?«
»Ja, ich, unser Dorfsowjet …«
»Na schön, Junge«, sagte er seufzend. »Geh nur, ich komm schon irgendwie allein klar. Geh. Und hab keine Bange. Ich versorg sie nur ein wenig, dann schickt mich meinetwegen ans Ende der Welt.«
Niedergeschmettert kam ich zurück in den Dorfsowjet. Ich erzählte alles Turdubajew. Sein Gesicht verfinsterte sich. Immerfort presste er seinen Bart in der Faust. Er hatte so eine Angewohnheit.
»Was schlägst du vor?«, fragte er in tonloßem Bass.
»Helfen Sie«, sagte ich. »Sie brauchen Heizmaterial, Heu, und mit Mehl ists bei ihnen auch schlecht bestellt. Die Kleinen frieren, man sieht ihnen an, dass sie hungern.«
»Was nötig ist, weiß ich allein. Du hast ihnen Hilfe versprochen, im Namen des Dorfsowjets, nun sieh zu, dass du dein Versprechen erfüllst. Sonst werden uns beiden die Leute nicht mehr glauben. Geh zum Kolchosvorsitzenden und setz durch, dass sie dir ein Fahrzeug geben und Heu ranschaffen, Stroh zum Heizen. Setz durch, dass sie ihnen Mehl und Kartoffeln zuteilen. Der Mann muss morgen zum Arbeitseinsatz fahren und wissen, dass hier die Sowjetmacht ist. Mag der eine alt sein und der andre klein – immerhin sind sie die Macht.«
Es war nicht so einfach, dem Kolchosvorsitzenden das Erforderliche abzuringen. Ich hatte ihm gerade noch gefehlt! Er habe im Kolchos genug eigene Sorgen. Für alles sei er verantwortlich: Erfüll den Plan, gib dies und das. Niemand sagte dem Kolchos: Da, nimm! Immer nur: Gib! Um geben zu können, müsse man arbeiten. Aber mit wem? Wer solle arbeiten? Es gäbe niemanden, der auch noch Heu und Stroh für die Wirtschaften ausfahren könnte. Wenn der Mann zum Arbeitseinsatz müsse, dann solle er doch losziehen; schließlich sei er nicht der Einzige. Das ganze Land kämpfe. Alle Familien litten Not, lebten ärmlich.
Musste ich gerade im ungünstigsten Moment beim Vorsitzenden auftauchen? Dem Mann schmerzte auch so das Herz. Doch ich blieb hartnäckig, argumentierte, so gut ich konnte, bettelte. In meiner Verzweiflung war ich bereit, zur Heugabel zu greifen. Wir standen auf dem Pferdehof. Als ich schließlich gesagt bekam: Da sind Pferde, da ist Geschirr, Stroh findest du auf dem Feld, bei der Tenne, Heu steht dort in Schobern, wir haben keinen, ders wegfahren kann, kümmre dich selber – da stürzte ich mich auch schon in die Arbeit, spannte Pferde an, schmiss ein paar Heugabeln auf den Wagen und fuhr polternd auf die Straße hinaus. Ich musste mich beeilen. Ein Wintertag ging schnell zur Neige. Auf der Straße hielt ich kurz beim Haus meines Vetters, Païsbek Mombekow. Er lebte bei Verwandten, der Vater war in der Armee, die Mutter gestorben, Païsbek selber unterrichtete, wie bereits gesagt, in der Schule, fünfzehn Jahre war er alt. Ich hatte Glück: Païsbek war zu Hause. Zu zweit fuhren wir aufs Feld Stroh holen. Wir packten den Wagen übervoll. Unterwegs kippte er uns um. Wir spannten die Pferde aus, richteten den Wagen – wenn auch mit großer Mühe – auf und beluden ihn wieder mit dem Stroh. Gegen Abend, noch bei Tageslicht, rollten wir in den Hof des Hirten. Hoch auf der Fuhre thronend, sah ich, dass er in seinem Garten bereits viele Bäume gefällt hatte. Keinen verschonte er. Wir luden das Stroh ab, er aber schwang unentwegt die Axt. Schließlich trat er näher, verschwitzt, mit dampfendem Rücken.
Wir schwiegen, und da sagte er: »Danke, Jungs. Ich hab gerade Pappeln als Brennholz geschlagen. Ein wenig müssen sie trocknen, dann werden sie damit heizen können, während ich weg bin. Schade, die Bäume waren noch jung. Aber was hilfts. Nach dem Krieg pflanzen wir neue, so Gott will, sollen die dann groß werden.«
Ich reichte ihm ein Papier mit der Anweisung des Vorsitzenden, seiner Familie Mehl und Kartoffeln auszuhändigen. Ich erinnere mich genau – acht Kilo Schrotmehl und zwanzig Kilo Kartoffeln. Heu, versprach ich, würden wir am nächsten Tag morgens bringen.
»Verzeih, Bruder, dass ich mich neulich so ereifert habe«, sagte der Hirte betreten. »Mir war himmelangst: die Kinder noch so klein und die Frau in letzter Zeit oft krank. Sie hat sich in den Bergen erkältet. Sonst hätt ich ja kein Wort verloren …«
Païsbek und ich brachten eine Säge, und wir zersägten an jenem Abend noch lange die gefällten Pappeln zu Klötzen, damit man sie dann in Scheite hacken konnte.
Ich kam sehr spät nach Hause, unterwegs von Hunden verfolgt. Und nachts fand ich keinen Schlaf. Ich fürchtete, ich könnte verschlafen. Frühmorgens musste ich das Sammeln der Einberufenen und ihre Abfahrt ins Kreiszentrum überwachen. Doch das war es nicht allein. Verschiedene Gedanken machten mir den Kopf schwer. Ich dachte an den Krieg. Früher hatte ich ihn mir so vorgestellt: unentwegtes Maschinengewehrfeuer und Heldentaten über Heldentaten, die Feinde fallen wie niedergemäht, die Unsern sind gegen alles gefeit … Diese naive kindliche Illusion brach grausam zusammen. Kein Tag verging, ohne dass im Dorfsowjet »schwarze Papiere« eintrafen, Gefallenenmeldungen von der Front. Den Heldentod starb dieser, dann jener, der dritte, der vierte … Am schrecklichsten war, die Familien der Gefallenen zu benachrichtigen. Obwohl alte Aksakale die bittere Kunde mit gebührender Würde überbrachten und der ganze Ail jeden Gefallenen beweinte, war es doch meine Aufgabe, den Betroffenen das »schwarze Papier« auszuhändigen. Nicht gleich, erst später, nach dem ersten Ausbruch von Verzweiflung und Leid. Und doch wars schrecklich, der amtlichen, von meinem Vorgänger geerbten Feldtasche das handtellergroße Stück bedruckten Papiers mit dem Militärstempel und den Unterschriften von Majoren, Hauptleuten oder anderen Stabsoffizieren zu entnehmen. Der Text beanspruchte nur wenige Zeilen. Leise lese ich, übersetze die Worte ins Kirgisische und verstumme. Mir antwortet ein tiefer, hoffnungsloser Seufzer, als löse sich schurrend ein Steinschlag vom Berg, ehe er prasselnd talwärts stürzt. Mir fällt schwer, die Augen zu heben, auch wenn mich keine Schuld trifft. Ich übergebe das Papier. »Verwahren Sie es«, sage ich. Jäh wird das unterdrückte, verhaltene Weinen der Mutter von krampfhaftem Schluchzen zerrissen und geht über in langes, unendlich leidvolles Weinen. Soll ihr wirklich dieses Papier den lebendigen Sohn ersetzen?!
Ich kann weder aufstehen noch weggehen oder trösten. Welche Worte brächten hier Trost? In solchen Augenblicken möchte ich am liebsten aus der Tür stürzen, ein Maschinengewehr packen, ja, ein Maschinengewehr, und mit ihm ohne Atempause dorthin rennen, an die Front, woher dieses Papier kam. Um dort, vor Wut und Zorn rasend, die Faschisten reihenweise niederzuschießen, reihenweise, aus dem unerschöpflichen, nie verstummenden Maschinengewehr. Aber das geschieht nur in Gedanken. Wer gäbe mir schon ein Maschinengewehr, einem Jungen, der obendrein noch klein ist! Ja, wäre ich wenigstens größer!
Endlich gehe ich, bedrückt vom Leid mir nahestehender Menschen. Ich gehe, über der Schulter die Feldtasche vom Dorfsowjet. Darin aber sind noch andere Gefallenenmeldungen.
Von dieser amtlichen Tasche aus der Vorkriegszeit – solche Taschen trugen gewöhnlich reisende Bevollmächtigte – erzählte ich einmal einem Landsmann, dem bekannten kirgisischen Schriftsteller Aschim Dshakypbekow, Chefredakteur des Studios Kirgisfilm. Die Tasche hatte seinem älteren Bruder Aitaaly gehört. Aschim ging damals in eine untere Schulklasse. Aitaaly indessen war ein umgänglicher Bursche, er mied uns nicht, sondern organisierte Kriegsspiele, führte uns auf Feldzügen an; dann aber schoß er unversehens in die Höhe, wurde erwachsen und arbeitete kurz vor dem Krieg als Sekretär des Dorfsowjets. Später, als ich an der Reihe war, den Sekretärposten zu übernehmen, fragte mich Nukejew bei der Übergabe der Geschäfte: »Hast du denn eine Tasche? Worin willst du die Papiere austragen?« Natürlich besaß ich keine Tasche, in die Schule gingen wir damals mit den Büchern unterm Gürtel. Da kramte er diese Tasche vom Boden des Schranks aus einem Haufen alter Papiere. »Da, nimm. Das ist die Tasche von Aitaaly. Sie lag noch dort, wo er sie hingeworfen hatte, als er zur Armee ging. Nimm und benutz sie. Du wirst doch Papiere nicht in der Hand tragen …«
So kam ich zu dieser Tasche. In ihr entdeckte ich allerlei dienstliche Notizen, alte Quittungen, nicht ausgehändigte Benachrichtungen über die Besteuerung von Wirtschaften und zwischen alledem auch einen Brief in Versen, eine Liebeserklärung. Aschyktyk kat lautete der Titel dieser Botschaft. Offenbar war Aitaaly nicht mehr dazu gekommen, sie dem Mädchen zu überreichen, für das sie bestimmt war. Ich wußte nicht, was ich damit tun sollte. Der Name des Mädchens war nicht angegeben. Nur die Initialen. Mir schien es unangebracht, diesen Brief jemandem zu zeigen, ich zerriss ihn in meiner Naivität und in meinem Unverstand. Später bedauerte ich das sehr. Als die Nachricht von Aitaalys Tod an der Front in diese Tasche geriet, begriff ich das Unüberlegte meines Tuns.
Zu meinen Obliegenheiten gehörte es, an die Familien von Frontsoldaten nach einem Verzeichnis winzige Bündel von primitiven Streichhölzern aus einem Industriekombinat zu verteilen, selbstgefertigte, in kleine Stücke geschnittene Seife, Garn und Petroleum – »ein Medizinfläschchen« pro Familie.
Armut, Entbehrungen, Leiden. Wer dachte nicht: Ob all das jemals endet? Sind der Prüfungen noch nicht genug? Doch nicht darin bestand die schlimmste Prüfung. Das Volk bewies große, unbeschreibliche Tapferkeit, beugte das Haupt nicht vor dem grimmigen Antlitz des Krieges. Mochte das Leben so schwer sein, dass es mitunter schien, die Kraft reiche nicht mehr für noch ein Unglück, für immer neue Bürden, und die menschliche Geduld sei erschöpft – die Menschen gaben nicht auf, unternahmen wieder und wieder, was nur in ihrer Macht stand.
Viel ist schon über die Frau der Kriegsjahre gesagt worden. Gebührend und zu Recht hat man sie als Werktätige und Mutter gepriesen. Und dennoch: Wäre ich Bildhauer oder Maler, mein Leben widmete ich ihrer Darstellung, bemüht, meiner Dankbarkeit, meiner Begeisterung, meinem Stolz und meinem Mitgefühl für diese große Gestalt des zwanzigsten Jahrhunderts Ausdruck zu verleihen.
Ich erinnere mich, einmal erschien im Dorfsowjet ein Maler von außerhalb, ein älterer Mann. Für Mehl malte er Porträts von Stachanowarbeiterinnen. Assija Dubanajewa, unsere schöne, beste Gruppenleiterin, fröhlich und umgänglich von Natur, wirkte auf dem Bild völlig verändert. Sie sah sich ähnlich und doch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Porträt erhalten geblieben ist. Ein junges, schönes Gesicht mit Augen voller Unruhe und Leid. Wir standen neben dem Maler und sahen ihm bei seiner Arbeit zu. Jemand sagte ihm, die Assija auf dem Bild sei doch gar nicht ähnlich.
»Sie ist all denen ähnlich, die auf ihre Männer warten«, entgegnete der Maler.
Leider sah unsere Assija ihren Mann nicht wieder. Ihre Jahre verrannen mit Warten und Arbeit, Arbeit und Warten.
Halbwüchsige sind trotz allem große Kinder. Aber neben den Frauen nahmen in jenen Tagen gerade sie die Männersorgen ums tägliche Brot auf ihre noch unentwickelten, halb kindlichen Schultern. Die zwölf-, dreizehnjährigen Jungen von damals wurden Pflüger und Getreidebauern. Im Jahr 1942 beschloss unser Kolchos in Scheker, zusätzlich über zweihundert Hektar Neuland mit Sommergetreide zu bestellen. »Brot für die Front!« Damit war alles gesagt. Aus heutiger Sicht ist es überhaupt kein Problem, ein paar hundert Hektar zu pflügen. Man fährt einen Traktor auf das Stück Land, und die Sache ist erledigt. Damals aber, mit Pferden, bei den wenigen Pflügen im Kolchos, war es eine Heldentat, so viel Ackerland über den Plan hinaus umzubrechen. Ja, eine Heldentat! Ein Vierergespann mit einem Zweischarpflug schafft an einem Tag im Höchstfall einen reichlichen halben Hektar Brache oder Neuland. Da kann man sichs ausrechnen …
Die Pflügerjungen mussten aus diesem außergewöhnlichen Grund die Schule verlassen. Schon im Winter begannen sie nämlich die Pferde vorzubereiten. Ein Zugpferd braucht tägliche unermüdliche Pflege, sonst macht es schon in den ersten Tagen der Saatkampagne schlapp. Die Arbeit mit dem Pflug ist in der Landwirtschaft die allerschwerste. Auf dem Dorf weiß das jeder.
Um mit dem Pflügen und der Aussaat zurande zu kommen, zogen die Jungen in jenem Jahr bereits in den ersten Frühlingstagen aufs Feld. Der Boden begann gerade erst zu atmen. Genaugenommen war der Winter noch nicht vorbei. Ich erinnere mich, als wäre es heute – wir hatten Ende Februar.
Gleich in den ersten Tagen ritt ich auf das Neuland in der Kök-Sai-Steppe, um nach meinen Kameraden zu sehen. Als ich frühmorgens aufbrach, war der Tag grau und trüb. Am Ziel aber begann es unversehens heftig zu schneien. Die Flocken wirbelten, hüllten alles in Weiß. Und für alle Zeit hat sich mir seitdem das Bild der kleinen Pflüger im Schneegestöber eingeprägt. Die Flocken waren groß, fielen dicht und tauten schnell. Sie erfüllten einen riesigen, öden Raum, verhüllten den Blick auf die ganze weiße Welt. Stille herrschte ringsum, Menschenleere, da war nichts als lautlos fallender Schnee. Doch die Pflüger ließen sich nicht beirren, trieben unermüdlich die Tiere an. Einen schwarzen Ackerstreifen entlang, der einen Hügel überspannte, zogen die Pflüge dahin, als wären es Schiffe, die im Nebel steile Wellenkämme bezwingen. Sie verschwanden hinterm Hang, als sänken sie in Wogentäler. Dann hörte man nur noch die Jungenstimmen. Ich ritt zu ihnen hin.
Die Pflüge tauchten aus dem Schneegestöber. In die Furche geduckt, hastig atmend, stemmten sich die Vierergespanne voran. Der Schnee taute augenblicklich auf ihren heißen Rücken, wurde zu weißem Dampf. Schwer hatten es die Gäule, die Erde unter ihren Füßen war feucht und glitschig, das Geschirr klitschnass. Aber auch die Jungen, die sie antrieben, hatten es nicht leichter. Ihre Köpfe bargen sie unter nässeschweren Säcken. Diese Jungen waren ja noch halbe Portionen. Bei solchem Wetter hätten sie besser in einem warmen Winkel sitzen sollen. Doch sie waren Kriegskinder, sie wussten, das war ihr Los und ihre Pflicht.
Es schneit und schneit … Durch den weißen Flockenwirbel kriechen die schwarzen Gespanne mit den Pflügen. Keinen Augenblick bleiben die Pflüge stehen … Ich erkenne die Jungen an den Stimmen: Baitik, Tairybek, Satar, Anatai, Sultanmurat … Meine Klassengefährten. Lange zögere ich, mich ihnen zu nähern – sie sollen nicht sehen, dass ich weine.
Im Winter widerfuhr uns ein schreckliches Unglück. Nachts klopfte es heftig ans Fenster. Aus dem Sattel gebeugt, schrie jemand: »Aufstehn! Schnell zum Pferdestall! Sie haben uns Pferde gestohlen!«
Im Handumdrehn war ich angezogen und rannte los. Aus allen Häusern stürzten Leute, warfen sich im Laufen schnell was über. Als ich mich dem Pferdestall näherte, hörte ich laute, erregte Stimmen. Wie sich herausstellte, hatten um Mitternacht, als der wachhabende Pferdewächter eingeschlafen war, Unbekannte die beiden besten Pferde aus ihrer Box am Tor herausgeholt. Der Wärter hatte zunächst gedacht, sie wären zufällig losgekommen, und begriff erst, als er entdeckte, dass mitsamt den Pferden auch die Sättel verschwunden waren. Da stürzte er hinaus, doch es war zu spät.
Wir mussten die Pferdediebe erwischen. Ohne erst zu satteln, sprang jeder auf irgendein Pferd, und schon preschten wir in verschiedenen Richtungen davon, ihnen nach. Was hätten wir schon tun können, wenn wir sie wirklich eingeholt hätten? Kein Pferdedieb hätte sich vor uns Jungen gefürchtet! Bis zum Morgengrauen durchsuchten wir Schluchten, Mulden und verlassene Winterhütten, aber nirgends fanden wir auch nur eine Spur. Es waren erfahrene Diebe. Wir waren fassungslos: Da hatten wir die Pferde für die Frühjahrsaussaat vorbereitet, hatten deswegen die Schule aufgegeben, und dann fanden sich Leute, die alles kaltließ.
Ich bemühe mich, möglichst zurückhaltend und lakonisch zu schreiben, denn es würde die Grenzen des Genres sprengen, wollte ich in allen Einzelheiten erzählen, was sich in jenen Jahren in unserem Scheker zutrug. Ich will versuchen, die Menschen und die Ereignisse zu gruppieren. Über meine Altersgefährten aus dem Dorf könnte ich noch viel Interessantes und Wissenswertes berichten, denn wir gehörten zu jener Generation von Halbwüchsigen, die schon am Tag nach dem Kriegsausbruch die Welt der Kindheit mit dem Strudel des Kriegslebens vertauschte, mit der leidvollen Wirklichkeit des Hinterlands; sie aber forderten von uns die Reife und den Mut von Erwachsenen.
Denke ich an meine damaligen Altersgefährten, dann gelange ich heute zu dem Schluss, dass meine Generation möglicherweise gerade durch die rauhen Verhältnisse so lebenstüchtig und charakterfest geworden ist. Das soll keineswegs heißen, der heutige materielle Wohlstand beeinträchtige die Lebenstüchtigkeit der Jugend. Im Gegenteil. Nur Unverstand verkehrt Gutes in Schlechtes. Jede Zeit stellt an den Menschen ihre Anforderungen, jede hat ihre Probleme, und daher ist das Leben niemals leicht, wenn man es ernst nimmt, etwas wagt und nicht bloß nach einem sorglosen Dasein trachtet. Ein Mensch, der in den Tag hinein lebt, stirbt als Persönlichkeit. Dabei konnten wir damals von solchen Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung, wie es sie heute gibt, nicht einmal träumen. Aber eigentlich geht es gar nicht darum. Ich möchte einfach sagen, dass unter meinen Altersgefährten aus der Kriegszeit nicht einer war, für den ich mich heute schämen müsste. Nicht ein einziger. Sie alle haben längst Familien, zumeist auch schon erwachsene Kinder, jeder geht seiner Arbeit nach, und ich bin sehr froh, sagen zu können, dass ihre Lebenswege von großer menschlicher Würde geprägt sind. Wen ich auch nehme, ich kann mich für jeden verbürgen. Die Brüder Taissarijew – die »Pflüger« Baitik und Tairybek – werken bis zum heutigen Tag, ohne die Hände in den Schoß zu legen, sind geachtete Männer im Ail, Kommunisten. Baitik ist Gruppenleiter, ein in der ganzen Republik angesehener Tabakbauer. Tairybek ist in der Feldwirtschaft ebenso unentbehrlich wie in der Viehzucht. Über Païsbek Mombekow sprach ich bereits – dreiunddreißig Jahre ist er Lehrer gewesen, ehe er vor zwei Jahren starb. Toktogul Ussubalijew hat es vom Rechnungsführer zum Kolchosvorsitzenden gebracht. Heute leitet er den Kolchos im benachbarten Bakaïr. Abdaly Nuralijew, ehemals Komsomolarbeiter, ist Kolchosaktivist. Toktogul Mambetkulow und Batima Orosmatowa unterrichten nun schon viele Jahre an der Schule die Kinder von Scheker. Nurija Dsholojewa und Orosgul Ussubalijewa arbeiten in fernliegenden Kreisen gleichfalls als Lehrer. Alymseït Doolbekow ist ein schon langjährig erfahrener Veterinärhelfer. Shaparbek Dossalijew arbeitet in einem Forstwirtschaftsbetrieb. Turgunbai Kasakbajew ist Vorsitzender eines der größten kirgisischen Kolchose. Im Kolchos Rossija gibt es allein sechzigtausend Schafe. Mirsabai Dsholdoschewa ist Hauptbuchhalterin eines ebenfalls sehr großen Kolchos in unserem Kreis Kirowskoje. Gapar Medetbekow ist ein bekannter Schauspieler am Dramatischen Theater von Naryn geworden …
So haben sich unsere Schicksale gefügt. Unter unsäglichen Mühen, aber nicht ziellos. Bei dem großen kasachischen Dichter Abai heißt es, das Leben gleiche der Bewegung des Meeres: So wie dort eine Wogenkette hinter der anderen herrolle, so folge auf die Welle einer »vorangegangenen Generation« die nächste, darauf die übernächste und so fort, ohne Ende. Und das Meer lebt.
Wenn ich an die Kriegsjahre zurückdenke, gelange ich zur Überzeugung, dass in unserer ethischen Entwicklung die »vorangegangene Welle« die entscheidende Rolle gespielt hat – die ältere Generation, die Generation der Frontsoldaten. Darüber könnte man sehr viel erzählen. Natürlich sind die Generationen stets miteinander verbunden. In friedlichen Zeiten vollzieht sich dieser Prozess auf natürliche Weise mittels Weitergabe von Erfahrungen und Traditionen. Im Krieg wurde das alles jäh unterbrochen. Unser stilles Scheker am Fuße des ewigen Manas, umgeben von Bergen, sah sich plötzlich im Strudel von Ereignissen, die die Welt erschütterten. Unsere Menschen, zum Schutz des Vaterlands aufgerufen, strömten an die Fronten, uns erreichten die Wogen der Evakuierten. Jenseits der Berge aber, durch die Bahnstation Maimak, die uns mit der Außenwelt verband, durch die nächstgelegene Stadt Dshambul, fuhren Tag und Nacht Militärzüge in die eine und in die andere Richtung – nach West und nach Ost. Hier pochte dröhnend der fiebrige Puls des kämpfenden Landes.
Einer der ersten, der uns aus eigener Erfahrung vom Krieg erzählte – von der Front, von Panzerangriffen, Bombenexplosionen und Waldbränden, vom Erlebnis der Schlachten, von Lazaretten und Militärchirurgen, von Tod und Tapferkeit –, war unser berühmter Ail-Sänger, der Dichter Myrsabai Ukujew. Er ist längst dahingegangen. Die Lieder von Myrsabai Ukujew aber kennt und singt man im Umkreis des Manas bis zum heutigen Tag.
Myrsabai Ukujew war der erste verwundete Frontsoldat, den unser ganzer Ail voller Freude, aber auch mit Bestürzung empfing, denn er wurde vom Wagen gehoben und bekam Krücken unter die Arme gesteckt: ihm fehlte ein Bein. Dergleichen hatten wir noch nie gesehen. Lahme und Krumme, die ja. Aber dass ein Bein hoch überm Knie einfach weg war, das war zumindest uns Jungen noch bei keinem begegnet. Es war schrecklich.
Früher einmal war er ein junger, schöner Lehrer gewesen. Er ritt auf einem grauen Passgänger, und sein Ross hieß Myrsabais dshorgo. Myrsabai sang gern und dichtete auch eigene Lieder, während er in die Saiten seiner Tschertmek griff. Und nun war er ohne Bein zurückgekommen; unnatürlich bleich von Lazarettaufenthalten und Bahntransporten, stand er auf Krücken inmitten der Dörfler, lächelte und weinte mit allen.
An jenem Abend sang Myrsabai vor einer großen Volksmenge Frontlieder, die er im Lazarett verfasst hatte. Das war für uns ein großes Ereignis, hat sich mir fürs ganze Leben eingeprägt. Wir alle waren ergriffen von Myrsabais Gesang, von seinem poetischen Bericht über den Krieg. Die Menschen lauschten mit angehaltenem Atem, gedachten der Ihren, die an die Front gegangen waren, lauschten und wischten sich Tränen ab. Er sang von sich, von seinen Regimentskameraden, doch das waren Lieder auch über einen jeden von uns, über das ganze Volk.
Stegreifpoesie ist schwer zu übersetzen und nachzuerzählen. Die Verskunst eines Akyn bezieht ihren Zauber daraus, dass man ihr Entstehen miterlebt – aus der Gleichzeitigkeit von Schöpfung und Vortrag. Dennoch will ich es versuchen. (Söhne verschiedener Völker – Russen, Kasachen, Usbeken und Kirgisen –, kamen wir uns in der Armee näher als Blutsverwandte. Wir haben eine Mutter – unsere Heimat; mit ihrer Milch hat sie uns alle genährt. Wie könnte unser Herz stumm bleiben, ihr Dshigiten, wenn unserer Mutter Unheil widerfährt? Gibt nicht sie uns Auftrieb, wenn wir einen steilen Berg hinauf müssen, schenkt nicht sie uns Hoffnung, wenn wir einen steilen Berg herunter müssen? Schwören wollen wir, wie unsere Helden einst schworen: Fällt uns der Tod, dann werden wir alle auf demselben Feld liegen, erringen wir den Sieg, dann werden wir alle auf demselben Berg stehen. So sprachen wir zueinander, während wir uns durch Wälder den Stätten näherten, wo wir auf die Faschisten stoßen sollten. Schon dröhnte unter unseren Füßen die Erde wie bei einem gewaltigen Erdbeben. Schon fielen Bomben, jagten mit ihrem grässlichen Heulen die Seele aus dem Körper und ließen schwarzen Staub gen Himmel stieben. Wir warfen uns in die Schlacht bei Leningrad …)
Das sang er seinen Ail-Gefährten. Besonders schön und rührend fanden wir jene Stelle in Myrsabais Geschichte, wo der Militärzug auf der Fahrt von Nowosibirsk an die Front offenbar seine Route änderte und unversehens auf jene Bahnstrecke geriet, die durch unsere Station Maimak führt. Im Morgengrauen passierte er, ohne die Geschwindigkeit zu vermindern, ohne Halt auf dem Bahnhof, die Maimak-Schlucht, den Tunnel, vorbei am Talas-Kamm, am Manas. Und offenbar improvisierte damals Myrsabai folgende Verse, die uns besonders erschütterten und seither zum Lied unseres Ails geworden sind. Es waren Abschiedsworte an die Berge des Alatau:
Meinem Blick entschwindet schon der Alatau,
der schneeblaue, wasserspendende Alatau.
Meinem Blick entschwindet schon unser Manas,
der weißhäuptige, väterliche Berg Manas.
Auf Wiedersehn, schneeblauer Alatau,
wünsch deinen Söhnen den Sieg über den Feind.
Auf Wiedersehn, väterlicher Berg Manas,
wünsch deinen Söhnen den Sieg über den Feind.
Gespiegelt in meinen Augen, nehm ich euch mit –
dich, schneeblauen, wasserspendenden Alatau,
dich, weißhäuptigen, väterlichen Berg Manas …
Wie oft haben wir dieses Lied dann als Willkommens- und Abschiedsgruß gesungen!
In jenem Winter gaben wir den achtzehnjährigen Burschen das Geleit. Noch gar nicht lange war es doch her, dass wir gemeinsam herumgetollt waren. Mochten sie auch ein wenig älter sein – sie waren einfach unsere Spielkameraden, unsere Gefährten gewesen. Jetzt zogen sie an die Front. Mit ihnen Dshumabai Orunbekow, mein Verwandter und Freund. Blutjung war er noch. Er hatte die Schule besucht, dann im Kolchos gearbeitet. Das war auch schon sein ganzes Leben, das er auf dem Schlachtfeld dahingab. Ich erinnere mich, wie er dieses Lied anstimmte, als die Jungen im Leiterwagen Platz genommen hatten.
Gespiegelt in meinen Augen, nehm ich euch mit –
dich, schneeblauen, wasserpendenden Alatau,
dich, weißhäuptigen, väterlichen Berg Manas
Und los ging die Fahrt, die Straße lang durch den Ail. Ihre Angehörigen liefen hinterm Wagen her. Nur Myrsabai blieb stehen, auf seine Krücken gestützt, und lauschte dem Abschiedslied an die Heimat, das noch lange zu ihm herüberscholl.
Myrsabai Ukujew genoss in unserem Ail wahrhaft große Achtung und Verehrung. Kein Ereignis ging ohne ihn vonstatten – ob Kolchosversammlung (von seiner Rückkehr bis ans Ende seiner Tage war er Rechnungsführer und ständig Mitglied der Parteileitung), ob Familienfeierlichkeiten, Willkommens- oder Abschiedsfeste –, in Freud und Leid für den Ail war Ukujew stets gern gesehen, wurde er gebraucht, gehörte er einfach dazu. Mit einem klugen Wort, einem Lied flößte er den Menschen Hoffnung ein, ließ er sie an den Sieg glauben und für ihn kämpfen.
In unserem Ail waren Groß und Klein stolz auf ihn und kannten seine Frontbiografie. Sie wussten die Namen aller, die mit ihm gedient hatten, wussten, wer sie waren und woher sie gekommen, sie kannten seine Kommandeure, denn von alldem handelte sein gesungenes Poem über den Krieg. Alle wussten auch, wie und unter welchen Umständen er verwundet, von wem er gerettet worden war.
Das war in den Wäldern um Leningrad geschehen, wohl im Sommer oder Herbst 41. Bei einem Gefecht explodierte eine Granate in nächster Nähe. Er erinnerte sich noch, wie etwas gegen sein Knie schlug. Als er wieder zur Besinnung kam, dauerte das Gefecht noch an, ringsum dröhnte alles von der Schießerei und den Detonationen. Er blutete stark, war außerstande, sich zu bewegen und wollte schon Abschied nehmen von der Welt – da erreichte ihn kriechend eine Sanitäterin. Das russische Mädchen Tanja. Im Ail nannten alle sie Tanija. Wenn doch unsere Tanija wüsste, wie Myrsabai Ukujews Dorfgenossen sie bewunderten, sie liebten! Schade, heute ist nicht mehr festzustellen, wer diese Tanja war, denn Myrsabai Ukujew lebt nicht mehr. Sie schaffte es, ihn zu verbinden und vom Schlachtfeld zu tragen. Über sie sang uns Myrsabai:
Welche Mutter nur gebar ein Mädchen,
dessen Güte keine übertrifft auf der Welt …
Jene Frau lieb ich mehr als die leibliche Mutter.
Welcher Vater nur erzog solch ein Mädchen,
dessen Kühnheit keine übertrifft auf der Welt …
Jenen Mann lieb ich mehr als den leiblichen
Vater …
Diese Zeilen zitiere ich freilich in sehr freier Übersetzung. Stegreifpoesie, die so sehr davon lebt, durch den Vortrag des Verfassers die Zuhörer unmittelbar zu erreichen, soll man vielleicht nicht schriftlich festhalten. Auf dem Papier stirbt sie wie eine zwischen den Seiten eines Buches vertrocknende Blume.
Die Nachkriegsjugend von Scheker schuldete Frontsoldaten wie Myrsabai Ukujew Dank. Er nahm es sich sehr zu Herzen, dass wir die Schule aufgeben mussten. 1944, als der Krieg bereits nach Westen gerollt war, als nach und nach arbeitsverpflichtete Männer und viele verwundete Frontsoldaten heimkehrten, beeilte sich Myrsabai, uns wieder zum Lernen zurückzuschicken. Ein Teil von uns setzte sich zu der Zeit schon wieder auf die Schulbank. Nach dem Krieg fuhr ich zum Studium am Zootechnikum nach Dshambul. Es war, ich muss schon sagen, eine sehr, sehr schwere, eine Hungerzeit. Eines Tages rief man in einer Pause zwischen den Lehrveranstaltungen nach mir: »Dich sucht ein Mann auf Krücken!« Ich lief auf den Hof – es war Myrsabai-aka. Lächelnd strich er sich über den Schnurrbart. Auch ich freute mich sehr.
»Ich hatte in der Stadt zu tun, im Materiallager, da dachte ich mir, ich schau mal nach, wie du mit der Wissenschaft klarkommst.«
Ich erzählte ihm von unserem Leben und Treiben. Er war zufrieden.
»Komm mit auf die Straße«, sagte er und humpelte vom Hof. »Ich hab dir was mitgebracht, es liegt im Wagen.«
Wir gingen zum Tor.
»Ich weiß doch, dass ihrs nicht leicht habt jetzt«, sagte er, »sehr schwer sogar. Laß dirs trotzdem nicht einfallen, das Studium hinzuschmeißen. Dazu haben wir jetzt kein Recht. Der Krieg ist zu Ende. Wenns gar zu schlimm wird, gib mir Bescheid. Wir lassen uns im Ail was einfallen. Aber lernen musst du.«
Ein Altersgefährte und Freund von Myrsabai Ukujew, für uns damals eine ebensolche Respektperson wie er, war der erste Mähdrescherfahrer unseres Ails, der alte Kommunist Toilubai Ussubalijew. Heute ist Toiluke-Aksakal, wie wir ihn nennen, Großvater einer zahlreichen Enkelschar. Sein Sohn, Sati Toilubajew, ist Hirte einer Eliteschafherde im Sowchos Kök-Sai. Satis Kinder wachsen heran wie eine ganze Abteilung. Große Achtung genießt Toilubai Ussubalijew bei seinen Nachkommen. Doch am Vorabend des dreißigsten Siegesjubiläums möchte ich die jungen Leute zusätzlich daran erinnern, dass Toiluke in den Kriegsjahren einer der wenigen war, die man ihren Bitten zum Trotz nicht an die Front schickte – er war für mehrere Kolchose der einzige Mähdrescherfahrer. Und wie er auf dem Mähdrescher arbeitete, ist längst Legende geworden. Niemand hielte jetzt so etwas für möglich, eine derartige Mähdrescherruine würde man heutzutage gar nicht erst reparieren, sondern sofort verschrotten, er aber übertrug die eigene Lebenskraft auf diese Ruine und erfüllte seine Pflicht. Es ist sein Mähdrescher, der in meiner Novelle Dshamilja eine Rolle spielt. Im Sommer 1944, während der Erntekampagne, war ich sein Gehilfe. Solange der Mähdrescher zu tun hatte, und seis Tag und Nacht, gönnten wir uns keine Ruhepause. Die Front musste versorgt werden, das Getreide duldete keinen Aufschub … Es war der heroischste Sommer meines Lebens. Nie werde ich jene Tage vergessen.
Und wieder ein Lied. Schon grünt das Gras am Wegrand, schon ziehen Herden mit ihrem Nachwuchs über die Berglehnen, die Hänge. Bestellte Felder huschen vorbei wie Spiegel – hier Wintersaaten, dort Hackfrüchte … Und wieder Felder, hier Hackfrüchte, dort Wintersaaten … Hinter mir zurück bleibt Dshambul, der unaufhaltsam wachsende, vom modernen Tempo der Urbanisierung erfüllte einstige Karawanenstützpunkt Aulije-Ata. Von hier aus fuhren meine Landsleute in Militärzügen an die Front, hierher, zur Eisenbahn, brachten wir unser Brotgetreide für die Front. Und da, unter den Wolken vor mir, erkenne ich bereits die Schneefelder des Manas.
Der Erste Sekretär des Dshambuler Gebietsparteikomitees, Assan Bekturganowitsch Bekturganow, während der Verteidigung Moskaus Politleiter einer Schikompanie, erzählte mir einmal, das Vermächtnis der Gefallenen an die Soldaten des Regiments laute: das Leben so zu gestalten, dass man der Toten mit Stolz und reinem Gewissen gedenke.
Das gleiche könnten wir auch von uns sagen, von dem zahllosen Volksheer im Hinterland während der Kriegsjahre. Daran musste ich unterwegs denken, die Schneefelder des väterlichen Berges Manas-Ata vor Augen.
(Essay für die Illustrierte Ogonjok, Nummer 19, 1975. Deutsch von Charlotte Kossuth.)
Alle Texte aus dem Band Karawane des Gewissens – Autobiographie, Literatur, Politik (Unionsverlag, 1988)
© by Unionsverlag, Zürich
Notizen über mich
Die eigene Biografie für die Lektüre anderer, für eine Veröffentlichung zu schreiben, ist eine ziemlich schwierige Sache. Was da wohl besser ist: Ausführlich sein Leben schildern oder möglichst kurz? Schreibst du viel, heißt es: Was zieht der sich in die Länge; schreibst du wenig: Wozu schrieb er denn das, wenn er gar nichts zu sagen hat? Am besten ist – gar nicht erst schreiben.
Aber wenn es nun einmal sein muss, will auch ich es versuchen. Ich bin schon über vierzig, da hat sich in meinem Leben wohl etwas getan.
In unserem Ail galt es als unbedingte Pflicht, seine Ahnen bis ins siebte Glied zu kennen. In dieser Hinsicht sind die Alten unerbittlich. Immer wieder prüften sie die Jungen: »Na denn, Batyr, sag an, aus welchem Geschlecht bist du, wer war der Vater deines Vaters? Und dessen Vater? Und seiner? Was für ein Mensch war er, was hat er gemacht, was reden die Leute über ihn?« Und stellt sich heraus, dass der Junge seine Ahnentafel nicht kennt, dringen die Vorwürfe bis zu den Ohren der Eltern. Was ist das nur für ein Vater ohne Sippe und Stamm?, sagt man dann. Worauf achtet der denn? Wie kann da ein Mensch aufwachsen, der seine Vorfahren nicht kennt? Und dergleichen mehr. Hier liegt der Sinn in der Abfolge der Generationen und der gegenseitigen moralischen Verantwortung in der Sippe. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen: Im Roman Der weiße Dampfer habe ich versucht, davon zu sprechen – durch den Mund des Jungen, als er sich mit dem auswärtigen Chauffeur unterhält.
Ich hätte meine Lebensbeschreibung auch mit diesem »feudalistischen Überbleibsel«, wie man das heute zu bezeichnen pflegt, anfangen können. Ich hätte sagen können, dass ich aus der Sippe Scheker stamme. Scheker ist unser Urahn, mein Vater ist Torekul, dessen Vater Altmat und dessen Vater Kimbildl und dessen Vater Kontschudshok. Doch das reicht. Weiter wäre das bloß eine Aufzählung von Namen, über die ich ganz und gar nichts weiß. Und die Leute gibt es schon nicht mehr, die mir über sie etwas erzählen könnten. Mein Ururgroßvater Kontschudshok ist mir nicht dem Namen, sondern dem Beinamen nach überliefert. Ein Leben lang hatte er Tscharyks getragen, Schuhe aus weißgegerbtem Leder, deshalb erhielt er auch den Beinamen Kontschudshok – der Schaftlose, also der ohne Stiefel. Folglich stammen wir von den »Schaftlosen« ab, kein Anlass, sich zu brüsten, aber so war es nun mal …
All dies und was ich noch erzähle, wurde mir übrigens nicht vom Vater mitgeteilt, er kam nicht dazu und musste sich auch um anderes kümmern. Ich verdanke das vor allem meiner Großmutter väterlicherseits, Ajimkan Satankysy, und ihrer Tochter, meiner Tante Karagys Aitmatowa. Erstaunlich, wie nah und ähnlich Mutter und Tochter sein können, im Äußeren wie auch in Charakter und Seelenart. Für mich waren die beiden untrennbar, gleichsam ein und dieselbe Großmutter in zwei Personen, die eine alt, die andere jung. Ich danke dem Schicksal, dass ich diese beiden bemerkenswerten, weisen und schönen Frauen sehen und kennen durfte – sie waren wirklich prächtig … Sie wurden auch meine Erzieherinnen, wo es um alte Bräuche und die Familienchronik ging.
Den Großvater Aitmat habe ich nicht mehr erlebt. Er starb um die Jahre 1918 bis 1920, und ich wurde 1928 geboren (am 12. Dezember). Am Rand unseres Ails Scheker (im Talas-Tal, Kirow-Rayon) liegt noch bis auf den heutigen Tag im Schwemmland des Kurkurëu ein alter, in die Erde gesunkener Mühlstein. Mit jedem Jahr verwittert er mehr und versinkt immer tiefer im Grund. Hier stand einst Großvaters Mühle.
Es heißt, er sei ein geschickter Mann gewesen, konnte nähen und brachte als erster eine Nähmaschine aus der Stadt, daher auch sein Spitzname »Maschinetschl-Altmat«, das heißt Schneider Altmat; Großvater konnte Sättel fertigen, verzinnen und löten, hervorragend auf dem Komus spielen und sogar die arabische Schrift lesen und schreiben. Trotz all seinem Unternehmungsgeist blieb er zeitlebens arm, er kam nie aus den Schulden und Nöten heraus, zeitweise war er sogar ein »Dshatak«, einer, der nicht nomadisiert, weil er kein Vieh hat.
Und da unternahm Großvater den verzweifelten Versuch, der Armut zu entrinnen. Er entschloss sich zum Bau einer Wassermühle, in der Hoffnung, die Einkünfte daraus würden ihn reich machen. Alles, was er und sein Bruder Birimkul besaßen, das gesamte Vermögen von zwei Haushalten, steckten sie in die Mühle. Den ganzen Sommer jenes Jahres hindurch gruben sie mit ihren Familien einen Ableitungsgraben vom Kurkurëti, der sollte der Mühle Wasser zuführen (heute kann man die Spur davon gerade noch erkennen), und gemeinsam errichteten sie Mauern und Dach. So verging ein Jahr, und die Mühle ging in Betrieb. Doch für den Pechvogel Altmat lief es wieder schief. Ein Feuer brach aus, und die Mühle brannte bis auf die Mühlsteine nieder. Endgültig ruiniert, zog Großvater mit dem zwölfjährigen Torekul, meinem Vater, zum Bau des Eisenbahntunnels bei der Station Majmak. Von hier aus kam mein Vater mithilfe der dortigen russischen Behörde an die russische Schule für Einheimische in der Stadt Aulije-Ata, dem heutigen Dshambul.
Ich schreibe das nicht, um eitel daherzuerzählen. Nichts geschieht auf der Welt ohne Grund. Wäre die unglückselige Mühle nicht abgebrannt, wäre Großvater nicht zur Eisenbahn gegangen, und Vater hätte wohl kaum in der Stadt zu lernen begonnen. Dass mein Vater in den ersten Jahren der Revolution bereits eine Bildung hatte (später studierte er noch zweimal in Moskau) und einer der ersten kirgisischen Kommunisten auf leitenden Posten war, dass er sich lebhaft für Politik und Literatur interessierte, dass auch meine Mutter – Nagima Chamsejewna Altmatowa – eine gebildete, durchaus moderne Frau war, all das ermöglichte, dass die beiden mich an die russische Kultur und Sprache heranführten, somit auch an die russische Literatur, die Kinderliteratur, versteht sich.
Andererseits nahm Großmutter mich, ihren Enkel, ständig in die Berge mit zu den Nomadensommerlagern, diese außergewöhnlich bezaubernde und kluge Frau war von allen im Ail geachtet und wurde für mich ein Schatz an Märchen, alten Liedern, Dichtungen und Wahrheiten. Ich sah noch die Nomadenzüge des Volkes, wie sie einst waren. Ein Nomadenzug ist kein bloßer Umzug mit den Herden von einem Ort zum andern, sondern eine große wirtschaftlich-rituelle Prozession. Ein originelles Ausstellen des besten Pferdegeschirrs, der besten Verzierungen, der besten Reitpferde, des besten Packgutes und des besten Teppichs, der auf den Kamelen all dies bedeckte. Eine Schau der besten Sängerinnen unter den Mädchen, die Trauerlieder anstimmten, wenn man einen Ort verließ, wo ein Nahestehender gestorben war, oder auch Wanderlieder. Ich habe diese prachtvollen Schauspiele erlebt, als sie schon am Aussterben waren, beim Obergang zur Sesshaftigkeit sind sie gänzlich verschwunden.
Wahrscheinlich hat mir Großmutter, ohne es selbst zu merken, die Liebe zur Muttersprache eingeimpft. Muttersprache! Was wurde darüber schon alles gesagt! Aber das Wunder der Muttersprache ist nicht zu erklären. Nur ihr trautes, in der Kindheit erfasstes und begriffenes Wort kann einen mit der Poesie erfüllen, die aus der Volkserfahrung stammt, sie kann im Menschen die ersten Quellen des Nationalstolzes wecken und den ästhetischen Genuss an der Vielfalt und Vieldeutigkeit der Sprache der Vorfahren vermitteln. Die Kindheit ist nicht nur eine herrliche Zeit, die Kindheit ist der Zellkern der künftigen Menschenpersönlichkeit. In der Kindheit wird das echte Wissen um die Muttersprache angelegt, da kommt das Empfinden für Zugehörigkeit auf – zu Menschen und Natur seiner Umwelt, zu einer bestimmten Kultur.
Ich kann, zumindest aufgrund meiner eigenen Erfahrung, sagen, dass sich ein Mensch in der Kindheit auf organische Weise zwei Sprachen aneignen kann, die ihm parallel zukommen, vielleicht sogar mehr als zwei, falls diese Sprachen von den ersten Jahren an in gleichem Maß einwirken. Für mich ist die russische Sprache nicht minder vertraut wie die kirgisische, von Kindheit an vertraut, und dies fürs ganze Leben.
Fünf Jahre war ich, als ich mich zum ersten Mal in der Rolle eines Dolmetschers befand, und ein Stück Siedfleisch war mein erstes »Honorar«. Es geschah im Sommerlager in den Bergen, wo ich wie üblich mit Großmutter war. In jenen Jahren waren die Kolchosen erst im Entstehen, sie begannen gerade, sich zu konsolidieren. In jenem Sommer hatte sich in unserem Dshajloo ein Unglück ereignet. Der Zuchthengst, den die Kolchose kurz zuvor gekauft hatte, verendete plötzlich. Am helllichten Tag brach er mit aufgedunsenem Wanst zusammen und gab den Geist auf. Die Pferdehirten waren tief bestürzt, der Hengst war wertvoll, ein Dongestütler, den man aus dem fernen Russland hergebracht hatte. Man schickte einen Boten zum Kolchos, von dort einen weiteren zum Rayon. Und nach zwei Tagen kam zu uns ein russischer Mensch. Hochgewachsen, mit rotem Bart und blauen Augen, in schwarzer Lederjacke, an seiner Seite hing eine Feldtasche. Ich habe ihn mir sehr gut eingeprägt. Er verstand kein Wörtchen Kirgisisch, und die unsrigen konnten kein Wort Russisch. Man musste eine Obduktion vornehmen, die Todesumstände des Tieres klären und ein Protokoll darüber aufsetzen. Die Pferdehirten beschlossen, ohne lang nachzudenken, dass ich der Dolmetscher sein musste. Ich aber stand derweil inmitten einer Schar Kinder, wir beäugten den Ankömmling.
»Komm«, sagte der Hirte zu mir und nahm mich bei der Hand. »Dieser Mann kennt unsere Sprache nicht, übersetz du, was er spricht, und was wir sagen, das wirst du ihm sagen.«
Ich genierte mich, war erschreckt, riss mich los und rannte zur Großmutter in die Jurte. Hinter mir drein, von Neugier geplagt, alle meine Freunde. Kurz danach kommt wieder jener Mann und beschwert sich über mich. Großmutter war sonst immer zärtlich, aber dieses Mal verfinsterte sich ihre Miene.
»Warum willst du mit dem Zugereisten nicht reden, die Großen bitten dich sogar darum, kannst du vielleicht kein Russisch?«
Ich schwieg. Hinter der Jurte hielten sich die Kinder versteckt – was würde nun passieren?
»Was ist mit dir, schämst du dich, russisch zu sprechen, oder schämst du dich der eigenen Sprache? Alle Sprachen sind von Gott gegeben, also zier dich nicht, gehn wir!« Sie fasste meine Hand und führte mich hin. Die Kinder wieder hinter uns her.
In der Jurte, wo zu Ehren des Gastes bereits ein frischer Hammel garte, drängte sich viel Volk. Sie tranken Kumys. Der zugereiste Veterinär saß mit den Aksakalen zusammen.
Er lächelte und winkte mich zu sich. »Komm her, Junge, wie heißt du denn?«
Ich murmelte still vor mich hin.
Er streichelte mich. »Frag sie, warum dieser Hengst verendet ist.« Er nahm sich Papier zum Schreiben.
Erwartungsvoll verstummten alle, aber ich zog mich in mein Schneckenhaus zurück und brachte kein Wort heraus. Großmutter saß bestürzt da. Da nahm mich ein alter Mann, ein Verwandter von uns, auf den Schoß. Er drückte mich an sich und sprach mir vertraulich und ernst ins Ohr: »Dieser Mann kennt deinen Vater. Was soll er ihm jetzt von uns erzählen? Soll er ihm sagen, was für ein schlechter Sohn ihm bei den Kirgisen heranwächst?« Und dann erklärte er laut: »Jetzt wird er sprechen. Sag unserem Gast, dass dieser Ort Uu-Sas heißt …«
»Onkel«, begann ich zaghaft, »dieser Ort heißt Uu-Sas, die giftige Wiese.« Und dann fasste ich mir ein Herz, ich sah, wie sich Großmutter und dieser Zugereiste freuten und auch alle anderen in der Jurte. Und fürs ganze Leben prägte sich mir diese Synchronübersetzung des Gesprächs ein – Wort für Wort, in beiden Sprachen. Der Hengst war wohl an dem giftigen Gras verendet. Auf die Frage, warum die anderen Pferde dieses Gras nicht fräßen, erläuterten unsere Pferdehirten, die einheimischen Gäule rührten es nicht an, sie wüssten, dass es ungenießbar sei. Genau so habe ich alles übersetzt.
Der Zugereiste lobte mich, die Aksakale gaben mir ein ganzes Stück heißes, duftendes Siedfleisch, ich sprang mit triumphierendem Blick aus der Jurte hinaus. Augenblicklich hatten mich die Kinder umringt. »Uch, toll!«, riefen sie begeistert aus. »Du sprudelst pausenlos auf Russisch daher, wie das Wasser im Fluss!« In Wirklichkeit hatte ich stockend gesprochen, aber den Kindern passte es eben, sich das so vorzustellen, wie sie es wollten. Auf der Stelle aßen wir das Fleisch auf und rannten spielen.
Lohnt es sich denn, in einer literarischen Biografie solche Dinge zu erwähnen? Ich meine schon. Man sollte mit den ersten Erinnerungen eines Menschen beginnen, wann und wie das gewesen ist. Manche erinnern sich zurück bis ins dritte Lebensjahr, andere können kaum das zehnte im Gedächtnis behalten. Ich bin überzeugt, dass all das viel zu bedeuten hat. In meiner Kindheit hat sich also diese Geschichte zugetragen. Großmutter war mit mir sehr zufrieden und erzählte noch lange danach ihren Bekannten von diesem Geschehnis, das ihr Herz mit Stolz erfüllte.
Sie verschönte meine Kindheit mit Märchen, mit Liedern und Begegnungen, mit Märchenerzählern und den Akyns, unseren Volkssängern, überallhin nahm sie mich mit. Sei es zu Besuchen oder zu einem Dshejentek, der Feier eines Neugeborenen, zu Beerdigungen und Hochzeiten. Sie hat mir oft ihre Träume erzählt. Diese Träume waren dermaßen interessant, dass sie nur ein Nickerchen zu machen brauchte und ich sie auf der Stelle weckte und aufforderte, mir zu erzählen, was sie im Traum gesehen habe. Kleine, kurze Träume befriedigten mich ganz und gar nicht. Da ging sie zu den Nachbarn, um sich »einen Traum auszuleihen«. Erst später wurde mir klar: Sie hatte sie sich einfach für mich ausgedacht.
Großmutter ist bald gestorben. Nun lebte ich ständig zu Haus, in der Stadt. Und ich ging dann zur Schule. Aber innert zwei Jahren verschlug es mich wieder in meinen heimatlichen Ail. Dieses Mal für lange Zeit und unter bedrückenden Umständen.
Im Jahr 1937 wurde mein Vater, Parteifunktionär und Hörer am Moskauer Institut der Roten Professur, von der Repression getroffen. Unsere Familie siedelte in den Ail um. Damals begann für mich die wahre Schule des Lebens, mit all ihren Verwicklungen.
In jener schweren Zeit hat uns Vaters Schwester Karagys-apa aufgenommen. Wie gut, dass wir sie hatten. Sie hat mir die Großmutter ersetzt. Wie ihre eigene Mutter war sie sehr geschickt, konnte Märchen erzählen und alte Lieder singen, im Ail genoss sie ebenfalls Achtung und Ansehen. Meine Mutter war schwer krank in den Ail gekommen, sie krankte noch lange, lange Jahre, aber wir waren vier Kinder, ich war der Älteste.
Unsere Lage war sehr bedrückend, aber Karagys-apa hat uns die Augen dafür geöffnet, dass der Mensch nicht verloren ist, wenn er sich inmitten seines Volkes befindet, so schwer seine Not auch sein mag. Nicht nur unsere Stammesbrüder, die Leute von Scheker – dieses »feudalistische Relikt« hat uns damals unschätzbare Dienste geleistet –, sondern auch die Nachbarn und bislang völlig Unbekannte haben uns nicht alleingelassen in der Not, sie wandten sich nicht ab von uns. Sie teilten mit uns, wo sie nur konnten – Brot, Heizmaterial, Kartoffeln und sogar warme Kleider.
Als einmal mein Bruder Ilgis und ich Reisig zum Heizen zusammentrugen – Ilgis ist jetzt Direktor des Instituts für Physik und Mechanik des Bergbaus an der Kirgisischen Akademie der Wissenschaften der Kirgisischen SSR –, näherte sich uns vom Weg ein Reiter, gut gekleidet und auf einem schönen Pferd. »Wessen Söhne seid ihr?« fragte er.
Unsere Karagys-apa hat uns immer wieder beigebracht, dass man in solchen Fällen den Menschen in die Augen blicken und den Namen seines Vaters sagen musste. Meinen Bruder und mich hat es sehr mitgenommen, was damals über unseren Vater geschrieben wurde, aber sie, Karagys-apa, schämte sich nicht unserer Schmach. Irgendwie hat diese Frau, die nicht lesen und schreiben konnte, begriffen, dass das alles erlogen war und nicht stimmen konnte. Ich habe schon damals Bücher über Kundschafter der Tscheka gelesen und insgeheim davon geträumt, man würde mich losschicken, einen Spion zu jagen, ich würde ihn schnappen und dabei zugrunde gehen, damit ich vor der Sowjetmacht auf die Weise die Unschuld meines Vaters unter Beweis stellen könnte.
Dieser Mann war also vom Weg hergeritten und hatte uns gefragt, wem wir gehörten. Und wenn es auch qualvoll war, habe ich, ohne die Augen zu senken, den Namen genannt. »Was hast du da für ein Buch?«, wollte er wissen.
Das war ein Schulbuch, wie ich mich entsinne, ein Lehrbuch für Geografie, das ich hinterm Gürtel eingeklemmt hatte. Er schaute es sich an und fragte: »Wollt ihr in die Schule gehen?«
Und ob! Wir nickten und bissen uns auf die Lippen, um nicht loszuheulen. »Schön, ihr könnt in die Schule!« Dann ritt er davon.
Schon nach einer Woche besuchten wir die Schule. Wie es sich herausstellte, war das einer unserer Lehrer gewesen, Tynalijew Üsübaly. Ich kam in die Klasse der Lehrerin Inkamal Dsholowaja, sie hat mir in jenen Tagen viel Mitgefühl entgegengebracht.
Ich habe früh zu arbeiten begonnen, mit zehn Jahren erfuhr ich, was Landarbeit heißt.
Nach einem Jahr zogen wir ins Rayonzentrum um, in das russische Dorf Kirowskoje. Mutter wurde dort als Buchhalterin eingestellt. Erneut besuchte ich eine russische Schule. Das Leben hatte sich ein wenig normalisiert, und da brach der Krieg aus.
Im Jahr 1942 musste ich die Schule aufgeben, uns alle zur Kriegszeit lernen zu lassen, war für Mutter zu viel.
Und so kam ich wieder heim nach Scheker, das von den Lasten des Krieges erdrückt wurde und abgewirtschaftet war. Man setzte mich als Sekretär des Dorfsowjets ein, unter den Halbwüchsigen war ich der bestausgebildete, ein anderer ließ sich für die Arbeit nicht finden. Ich war vierzehn Jahre.
Aber wo Unglück, ist auch Glück, wie man so sagt. Wenn ich in der Kindheit das Leben von seiner poetischen und hellen Seite kennenlernte, zeigte es sich mir nun von seiner harten, nackten, leidvollen und heldenhaften Seite. Ich sah mein Volk in seiner anderen Verfassung – im Augenblick der größten Gefahr für die Heimat, in der äußersten Anspannung seiner geistigen und physischen Kräfte. Ich war gezwungen und verpflichtet, das zu sehen, ich kannte jede Familie im Bereich des Dorfsowjets, kannte jedes Mitglied einer Familie sowie die ausnahmslos karge Ausstattung aller Höfe. Ich lernte das Leben von seinen verschiedenen Seiten und in unterschiedlichen Äußerungen kennen.
Sodann arbeitete ich während der Kriegsjahre als Finanzbeamter der Rayonverwaltung und trieb von der Bevölkerung Steuern ein. Hätte ich vorher gewusst, wie schwierig das in Zeiten von Krieg und Hunger ist! Das war so qualvoll für mich, dass ich nach einem Jahr, im August 1944, diese Arbeit eigenmächtig hinwarf und dafür beinahe vor Gericht kam. Ich war dann als Rechnungsführer bei einer Traktoristenbrigade zur Getreideernte.
Der Krieg dauerte an, und das Leben erschloss mir, dem Jüngling, immer mehr und neue Seiten im Dasein des Volkes. All dies hat viel später, so gut es mir gelang, in den Novellen Aug in Auge, Der Weg des Schnitters, teilweise auch in Dshamilja und Du meine Pappel im roten Kopftuch Gestalt angenommen.
Im Jahr 1946, nach Abschluss der achten Klasse, immatrikulierte ich mich am Zootechnikum von Dshambul. Das ganze Praktikum von 1947 bis 1948 verbrachte ich daheim im Ail und konnte somit wie ein Außenstehender die Nachkriegsveränderungen im Leben der mir nahestehenden Menschen beobachten.
Nach Abschluss des Technikums im selben Jahr wurde ich als Bestabsolvent im Kirgisischen Landwirtschaftsinstitut angenommen, das ich übrigens auch mit Auszeichnung abschloss.
Die Literatur liebe ich seit der Kindheit, in der Schule verfasste ich gern Aufsätze zu Themen freier Wahl, und schon während der Institutsjahre war mir klar geworden, dass mich die schöngeistige Literatur immer stärker in ihren Bann zog. In den Vorbildern aus der Literatur jener Zeit suchte ich Antworten auf die Fragen, die mich bewegten. Ich wünschte mir sehr, dass kraftvolle, eindringliche Werke über den Krieg und die Ruhmestaten des Volkes geschrieben würden. In der kirgisischen Literatur war damals das Kriegsthema noch nicht tiefgründig erfasst. Ich wünschte mir, dass auch die kirgisische Leserschaft die Möglichkeit erhielt, die besten Bücher über den Krieg kennenzulernen. Von diesem Gefühl getrieben, machte ich mich daran, den Sohn des Regiments und die Weiße Birke auf eigenes Risiko zu übersetzen, ohne die geringste Vorstellung, was schöngeistiges Übersetzen und die Herausgabe eines Buches bedeuten. Als ich meine Übersetzungen zum Verlag brachte, wurde mir gesagt, dass diese Bücher längst übersetzt seien und demnächst herauskämen.
Mich hat das damals ziemlich getroffen, aber ausgerechnet dies war der Beginn meiner literarischen Arbeit. Schon als Student schrieb ich Glossen, Artikel und Skizzen für Zeitungen.
Nach dem Institut arbeitete ich als Zootechniker. In jenen Jahren verfasste ich schon Erzählungen. Im Jahr 1956 begab ich mich nach Moskau und nahm an höheren Literaturkursen teil. Diese zwei Studienjahre haben mir, dem ehemaligen Zootechniker, außerordentlich viel vermittelt. Das betraf nicht nur die geisteswissenschaftliche und theoretische Ausbildung, sondern auch die unmittelbare Praxis – unsere Seminare und Diskussionen in den Oberkursen waren eine gute Schule fürs Schöpferische. Und ich selbst bemühte mich darum, am Besten des Moskauer Kulturlebens teilzuhaben, in der Literatur wie im Theater. Nach diesen Lehrgängen arbeitete ich als Chefredakteur bei der Zeitschrift Literaturnyi Kirgisstan, danach als Korrespondent der Prawda in Kirgisien, auch dies erweiterte den Kreis meiner Beobachtungen und ließ mich das Leben besser kennenlernen.
Ein Schriftsteller muss natürlich von Natur aus über die Fähigkeit verfügen, künstlerisch zu denken, aber seine Begabung und Persönlichkeit formen sich in Verbindung mit einem bestimmten Gesellschaftsmilieu, der geistigen Erfahrung und den Kulturtraditionen dieser Umgebung, mit deren Weltanschauung und politischem Aufbau. Für uns ist diese Welt die sowjetische Gesellschaft, die sozialistische Ordnung, die kommunistische Weltanschauung. Daraus entspringt die Orientierung im Schaffen von sowjetischen Schriftstellern.
Man muss nicht speziell betonen, dass 1963 die Verleihung des Leninpreises für das Buch Erzählungen der Berge und Steppen ein freudiges, ungeheures Ereignis in meinem Leben war. Ich bin dem Volk dankbar für diese höchste Ehre.
Niemand wird zum Schriftsteller allein aus sich selbst heraus: Die Erfahrung der Vorausgegangenen fließt ein in die Schöpferwelt des Künstlers, lange bevor er in sich literarische Neigungen erkennt. Freilich ist es bei Weitem nicht allen von uns gegeben, auf dem schwierigen Weg der Kunst Neues zu entdecken und zu vollenden. Das hängt dann schon von der Begabung und der Weite der Lebensanschauung ab. Oftmals treten wir auf der Stelle, die bereits die Vorgänger erreicht hatten, häufig gehen wir rückwärts, was Meisterschaft, Gedankentiefe, Gestaltungskraft und Bildhaftigkeit betrifft. Offenbar vollzieht sich so der literarische Entwicklungsprozess: Verwickelt, langwierig, ungleichmäßig, mitunter schwer erklärbar.
Über die Schicksale der Literatur und den eigenen schöpferischen Weg muss man oft und aus verschiedenen Anlässen nachdenken. Da ich von mir spreche, möchte ich mich hier über den Weißen Dampfer äußern, der unter den Lesern diverse Auseinandersetzungen hervorgerufen hat. Kontroversen gehören dazu, die Literatur hat sie nötig. Aber was mich hier die Ohren spitzen ließ, war, so paradox das klingt, die Gefahr einer äußerst wohlwollenden, meiner Meinung nach sehr ehrlichen Kritik. Manche Leser, denen etwa Dshamilja, Der erste Lehrer, Der Weg des Schnitters und andere Werke gefallen haben, möchten, ausgehend von ihren Vorstellungen über die Kunst, dass ich auch künftig nur in diesem Geist schreibe. Ich denke nicht daran, mich selbst zu verleugnen, leugne auch nicht die Bedeutung dessen, was vor Abschied von Gülsary und Der weiße Dampfer entstand, aber ich habe auch nicht vor, darauf festzusitzen, was für mich eine bereits zurückgelegte Etappe darstellt. Die Literatur muss selbstlos ihr Kreuz tragen und in die Verwicklungen des Lebens eindringen, damit der Mensch das Gute, Beste und Würdigste in sich, in den Menschen und der Gesellschaft kennt, liebt und darum bangt. Darin sehe ich die wahre Bestimmung der Kunst. Und mir scheint – das ist meine Überzeugung –, dass es auf immer so bleiben muss, da ja der Mensch in der Kunst auf der Suche, ist und seine besten Bestrebungen bestätigt und all das abgelehnt haben will, was das Böse ausmacht und seinen sozialen und sittlichen Idealen widerspricht. Das geht nicht ab ohne Kämpfe, Zweifel und Hoffnungen. Und so wird es wohl ewig bleiben. Daher hat die Kunst dem Menschen immer und ewig über die Kompliziertheit und Schönheit des Lebens zu erzählen.
Ich weiß nicht, wie sich mein weiteres künstlerisches Schicksal fügen wird und ob ich etwas Interessantes werde machen können. Wie heißt es doch: Warten wirs ab, wir werden sehen.
(Die erste Autobiografie, geschrieben in Frunse 1971, veröffentlicht in Sowjetskije pisateli – Sowjetische Schriftsteller, Autobiografien, Band 4, Moskau 1972)
Schnee auf dem Manas-Ata
Nach Scheker fahre ich ziemlich oft: zwei-, dreimal im Jahr. Zu verschiedenen Anlässen wie Hochzeiten und Beerdigungen. Gern würde ich auch meine Söhne, typische Städter, bewegen, engen Kontakt zu unseren Landsleuten aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Wies scheint, ändern sich die Zeiten.
Unser Scheker ist ein großer, fest verwurzelter Ail mit reichlich dreihundert Wirtschaften. Wann ich auch hinkomme, entdecke ich hier und da neue Häuser unter neuen Dächern. Es werden immer mehr Familienhöfe. Der Ail wächst. Und er ist unübersehbar, liegt, wie man bei uns sagt, »an des Wassers Kopf«, am Fuß des Talas-Gebirges, des Pik Manas – genau unterm Sattel von dessen doppelköpfigem Gipfel. Diesen hochragenden Berg pflegte der Recke Manas auf seinem Ross zu erstürmen, um die Gegend ringsum zu betrachten – ob nicht Feinde im Anzug wären. (Man kann sich unschwer vorstellen, welch riesigen Raum Manas von jener Höhe überschaute. Es sind wahrhaft epische Maßstäbe! So wollte vor alten Zeiten das Volk seinen Sohn und Helden Manas sehen.) Wie dem auch sei, von dort, unterm ewigen Schnee des Manas hervor, kommt der ungestüme und eiskalte Kukurëu ins Tal, bringt Wasser und also auch Leben allem auf Erden …
Ich bin immer bewegt, wenn ich mich Scheker nähere und bereits von fern – funkelnd in unzugänglicher himmlischer Höhe – die bläulichweißen Schneefelder des Manas erblicke. Überlässt man sich diesem Bild, schaut lange Zeit nur auf diesen Gipfel, auf den Himmel, dann scheint die Zeit stehenzubleiben. Es schwindet das Gefühl für Vergangenes. Nein, denke ich, nichts ist geschehen, nichts hat sich verändert, auf der Welt ist alles noch so wie vor zehn, zwanzig, ja vielleicht hundert und tausend Jahren. Der Manas steht da wie einst. Nach wie vor ziehen Wolken über ihn hin, dieselben Wolken. Und ich bin immer noch der Junge von einst, der des Morgens aus dem Haus läuft, diesen Berg überm Ail sieht und sich darüber freut. Doch leider, sich in Träumen verlieren kann man nur für ein, zwei Minuten …
Diesmal war ich bei meiner Fahrt nach Scheker aufgewühlter als sonst. Das hatte seinen Grund. Die Redaktion des Ogonjok hatte mich um einen Report über das Leben meiner Landsleute im Krieg gebeten. Zuerst hegte ich Zweifel: Was gibt es da schon groß zu berichten, Hinterland bleibt Hinterland. Krieg – das sind die Front, die Schlachten, dann erst kommt alles übrige. Diese Zweifel begleiteten mich den ganzen Weg. Als ich mich jedoch dem Ail näherte, die ewigen Schneefelder des Manas vor Augen, erinnerte ich mich an vieles.
Meine Kindheit, alle Kriegs- und Nachkriegsjahre hatte ich hier verbracht, in dieser Gegend, dem damaligen Ailsowjet Scheker. Ebenjene Zeit und die Menschen jener Tage gingen mir nun durch den Sinn. Es waren ganz normale Leute – Werktätige, Bauern, Aktivisten, wie man sie in jedem Kolchos oder Sowchos antrifft. Wenn ich heute an den Krieg denke, sehe ich jeden gewissermaßen in Großaufnahme, in greller und voller Beleuchtung durch die Kriegsereignisse. An die Kundgebungen der ersten Kriegstage erinnere ich mich. Die gemeinschaftliche Verantwortung für das Schicksal des Landes wurde zur persönlichen. Unmittelbar von den Kundgebungen verließen Freiwilligenkolonnen das Kreiszentrum in Richtung Front. Wie ich es heute sehe, fand ein jeder, ob groß oder klein, an der Front oder im Hinterland seinen historischen Platz in diesem grandiosen Volkskampf … Ja, den historischen Platz. Anders kann man es nicht nennen.
Und daher sind es keine bloßen Redensarten, wenn wir sagen: »vor dem Krieg«, »nach dem Krieg«, »im Krieg«. Für mich liegt mehr in diesen Worten als die Chronologie der Ereignisse, für mich spricht aus ihnen eine Zeit bitterer Lebenserkenntnis, eine Zeit, in der unsere Gesellschaft Erfahrungen von universellem Rang erwarb. Denn der Krieg unterteilte nicht nur als globaler historischer Markstein die Menschheitsentwicklung im zwanzigsten Jahrhundert in ihre Vorkriegs- und ihre Nachkriegsperiode, sondern wurde auch zum Schicksal eines jeden, der ihn erlebte, zum Kriterium seiner Handlungen und sittlichen Werte. Der Krieg griff buchstäblich in jedermanns Leben ein, ich kenne keinen, der sich ihm so oder so hätte entziehen können. Wer das versuchte, geriet unvermeidlich mit dem Volk in Konflikt, denn wo es um die Existenz des ganzen Volkes ging, durfte es keine Ausnahme geben. (Diesem Thema widmete ich denn auch meine erste kleine Novelle, Aug in Auge.) Einem jeden präsentierte der Krieg auf seinem Lebensweg die größte Rechnung der Epoche …
Hier schulde ich schon Auskunft über die eigenen Erfahrungen. Bei Kriegsausbruch war ich dreizehn Jahre alt. Da also begann für meine Generation die Entdeckung der großen Welt. Jetzt kann ich es selbst kaum fassen, doch schon mit vierzehn Jahren arbeitete ich als Sekretär des Ailsowjets. Mit vierzehn Jahren musste ich recht komplizierte gesellschaftliche und administrative Fragen entscheiden, die auf verschiedenste Weise – noch dazu unter Kriegsbedingungen! – das Leben eines großen Dorfes betrafen. Doch damals war das gar nicht außergewöhnlich. Jungen, die 1941 die siebente Klasse beendet hatten, unterrichteten bereits in unseren Klassen – so Païsbek Mombekow (ein Leben lang, dreiunddreißig Jahre, war der Mann dann als Lehrer tätig!) und der heutige Direktor der Mittelschule von Scheker, Sejtaly Bekmambetow. Nach dem Krieg erst konnten sie studieren. Mein Bruder Ilgis, heute Direktor des Instituts für Gesteinsphysik und -mechanik bei der Kirgisischen Akademie der Wissenschaften, ist drei Jahre jünger als ich. Er ging damals zur Schule und arbeitete zugleich als Briefträger. Den ganzen Krieg über. Ich bin stolz auf ihn. Ein prächtiger und gewissenhafter Briefträger war er in jener bitteren Zeit. Der barfüßige, schmächtige Elfjährige – so einen würde man heutzutage kaum allein in eine nahe Straße gehen lassen – lief nach Soldatenbriefen und Zeitungen, die er dann den Leuten bei der Feldarbeit vorlas, viele Kilometer weit, über einen Fluss ins Nachbardorf, wo die Post war. Fünfzehn Jahre war er alt, als er – von der Vollversammlung des Kolchos Dshijde vorgeschlagen – die Medaille »Für hervorragende Arbeit im Großen Vaterländischen Krieg 1941–1945« erhielt. Er hat sie verdient. Das kann ich bestätigen. Doch nicht darum geht es. Im Grunde verdanken wir beide, wie viele Halbwüchsige der Kriegsjahre, unsere besten Eigenschaften älteren Menschen, die uns mit Wort und Tat durch ihr Beispiel erzogen.
Ich weiß noch, im Winter 1942 wurde ich einmal vom Boten des Dorfsowjets, Kenesch, aus dem Haus gerufen. »Steig zu mir aufs Pferd, Söhnchen«, sagte er. »Die Obrigkeit will es. Sicher gehts um etwas Wichtiges.« Er nahm den Fuß aus dem Steigbügel, zog mich auf die Kruppe des Pferdes, und wir beide ritten los. Er saß vorn, ich hinten.
Er war gleichfalls eine interessante Persönlichkeit in unserem Ail. Eigentlich hieß er Ibraïm. Doch weit und breit nannten ihn alle Kenesch. »Kenesch« heißt »Sowjet« und steht für »Sowjetmacht«. Er, der Ärmste der Armen, hatte als Erster im Ail seine Stimme laut für die Erretterin der Armen, die Sowjetmacht, erhoben, war unser erster Landarbeiterdeputierter in den Jahren nach der Revolution. Ebendas zeichnete diesen lese- und schreibunkundigen Landarbeiter aus: Sein Leben lang agierte er auf allen großen und kleinen Versammlungen für die Sowjetmacht. Und stets versicherte er dabei, für sich persönlich keinerlei Vorteil zu suchen. »Für mich ein Stück Brot und fürs Pferd ein Bündel Heu – mehr brauch ich nicht. Für die Sowjetmacht aber werde ich Tag und Nacht arbeiten, bis ich aus dem Sattel falle.« Als es darum ging, eine Staatsanleihe zu zeichnen, gab er seine letzte Ziege weg. So arbeitete er bis zum Ende seiner Tage als Bote und freiwilliger Agitator und starb, man kann schon sagen, tatsächlich im Sattel. An den Hängen des Manas gedenken die Menschen seiner bis zum heutigen Tag. Und bis zum heutigen Tag voller Staunen. In den Kriegsjahren war Kenesch bereits alt, doch seine aktive, leidenschaftliche Natur ließ sich nicht unterkriegen – einige Male war ich Zeuge seiner »spontanen« Agitationsreden auf Versammlungen. Man spürte die Erfahrung des Landarbeiterdeputierten, er sprach mit innerer Anteilnahme, seine Worte kamen von Herzen, zündeten …
Dieser Mann also brachte mich in den Dorfsowjet. In dem kalten, ungeheizten Raum mit dem Erdfußboden und den kleinen Fenstern aus Glasbruchstücken saßen drei Männer. Der hochgewachsene Graubart im Pelz, ein älterer Hirt aus Artschagul, dem Nachbar-Ail jenseits des Flusses, war Kabylbek Turdubajew – Vorsitzender unseres Dorfsowjets, seit der frühere an die Front gegangen war. Die beiden anderen in Soldatenmänteln waren verwundete Frontsoldaten: der Kolchosvorsitzende Alischer Aidarow, erst kürzlich aus dem Krieg heimgekommen, noch mit verbundenem Arm, und der Sekretär des Dorfsowjets, Kaly Nukejew, mit Krücken, die an der Wand lehnten. (Alle drei Veteranen sind noch am Leben: Kabylbek Turdubajew ist Rentner und verdienter Kolchosbauer, Alischer Aidarow Agronom beim Tabakanbau, Kaly Nukejew Vorsitzender des benachbarten Dorfsowjets Kök-Sai.)
»Die Schule musst du einstweilen verlassen«, sagte mir damals Turdubajew. »Später holst du alles nach. Wenn der Krieg vorbei ist. Denn Kaly wird Brigadier …« Er nickte zu Nukejew hin. »Mit seinen Krücken hätte er es natürlich viel leichter als Sekretär. Aber ohne Brigadier gehts nicht im Kolchos. Das verstehst du doch selber. Und sonst kann das keiner. Mir aber fehlt es an Schulwissen. Mein Lebtag hatte ich nur mit Vieh zu tun. Ich brauch einen gescheiten Gehilfen. Da haben wir also beschlossen, du machst diese Arbeit …«
So wurde ich Sekretär des Dorfsowjets. Artschagul, der Ail jenseits des Flusses, gehörte auch noch zu uns. Zwei große Aile, die unruhige Kriegszeit – der Vorsitzende aber kam von der Schafherde und der Sekretär von der Schulbank. So war die Lage. Das Leben indessen nahm seinen Lauf, stellte uns vor Aufgaben, die keinen Aufschub duldeten. Arbeit gab es zur Genüge. Und mit meinem Wissen war es auch nicht weit her. So verfügte das Kreisexekutivkomitee in einem Papier für das Territorium des Dorfsowjets eine »Malleïnisierung« – das war, wie sich später herausstellte, ein veterinärmedizinischer Terminus, und er bedeutete die Spezialbehandlung des Pferdebestandes mit irgendwelchen Präparaten. Ich aber sagte Turdubajew, uns erwarte eine »Mobilisierung« aller Pferde. Er wurde ganz grau im Gesicht. »Und was machen wir hier in den Kolchosen ohne Zugtiere?« Also begaben wir uns auf schnellstem Weg ins Kreiszentrum, ins Dorf Kirowskoje, vierzig Kilometer weit. Um Mitternacht ritten wir los. Trafen schließlich ein, voller Unruhe. Doch dort erklärte man uns alles. Es war einfach ein Missverständnis. Wie wir dann aus dem Kreisexekutivkomitee treten und die Pferde besteigen wollen – ich hatte ein großes Tier erwischt, war aber selber klein, trug obendrein Pelzmantel und Pelzmütze und war gegürtet, denn es war Winter –, da bekomme ich doch den Fuß nicht in den Steigbügel; es war einfach nichts zu machen. Wir mussten aber noch schleunigst zur Bank. Während ich vergeblich versuchte, aufs Pferd zu klettern, hob mich Turdubajew hoch – er war ein kräftiger Mann –, und schon saß ich im Sattel. Auch noch diese Schmach! Was war ich für ein Dorfsowjetsekretär, wenn man mich wie ein kleines Kind in den Sattel setzte!
»Ich mach die Arbeit nicht länger!«, erklärte ich ziemlich schroff.
»Es hat ja keiner gesehen«, beschwichtigte mich Turdubajew. »Und von der Arbeit kommst du nicht los. Du musst eben noch lernen. Sowie der Krieg aus ist, gehst du wieder in die Schule. Vorwärts!«
Heute, nach vielen Jahren, danke ich dem Schicksal, dass es mich sozusagen von Kind auf mit interessanten, würdigen Menschen zusammengeführt hat. Einer von ihnen war mein Dorfsowjetvorsitzender, der weise Aksakal Turdubajew, ein ehemaliger Hirte. Anderthalb Jahre darauf, als Leute mit Schulbildung aufgetaucht waren, verwundete Offiziere, kehrte er wieder zu seinem ursprünglichen Beruf zurück. Viel später einmal trafen wir uns beim Totenmahl für einen uns nahestehenden Menschen, kamen ins Gespräch und erinnerten uns natürlich an die gemeinsame Arbeit im Dorfsowjet. Ich dachte, der alte Mann würde – wie bei solchen Gelegenheiten üblich – darüber scherzen, dass damals, da es nichts anderes gab, eine Schnepfe für eine Ente herhalten musste. Aber nein, er unterhielt sich durchaus ernst. »Oft überlege ich noch«, sagte er, »ob wir damals alles so gemacht haben, wie es nötig gewesen wäre.«
Nötig aber war viel in dieser schweren, harten Zeit. Unentwegt wurden Menschen mobilisiert. An die Front, zum Arbeitseinsatz, für Bergwerke, zur Holzbeschaffung und sogar zur Arbeit am Tschu-Kanal, der in jenen Jahren weitergebaut wurde. Wir beschränkten uns nicht darauf, den Leuten ihre Gestellungsbefehle auszuhändigen und alles amtlich zu registrieren. Turdubajew hielt es für seine Pflicht, mit jedem Einberufenen und mit dessen Familie zu reden, da zu überzeugen, dort mit Rat und Tat zu helfen, stets gab er ihnen ein gutes Wort mit auf den Weg, fuhr oft selbst mit ihnen ins Kreiszentrum und ins Militärkommissariat, blieb an ihrer Seite bis zum Abtransport. Einige Male übertrug er diese Aufgabe auch mir, obwohl ich dafür kaum die geeignete Person war. Wie sehr ich mich auch bemühte, gesetzt zu wirken, Junge bleibt Junge.
Einmal geschah Folgendes. Ein Hirte, der zum Arbeitseinsatz einberufen war, erschien nicht zum festgesetzten Termin im Dorfsowjet, um ins Kreiszentrum verabschiedet zu werden. Den Boten schickte er unverrichteter Dinge weg. Ich musste zu ihm hin. Der Mann empfing mich auf der Schwelle seines Hauses, wütend und gereizt. Ehrlich gesagt, er hatte recht. Das ganze Jahr über war er mit einer Schafherde herumgezogen, hatte mit Frau und Kindern nomadisiert. Vier Hirten waren dafür vorgesehen, er hatte mit seiner Frau allein gearbeitet. Für seine Arbeitseinheiten hatte er nichts bekommen. Jetzt wurde er einberufen. Von den Bergen war er in sein unbewohntes, verlassenes Haus im Ail heruntergestiegen. Dort aber war alles wie leergefegt, es gab keinerlei Vorräte, weder Heizmaterial noch Kleidung, noch Futter für die Kuh.
»Wie kann ich losfahren und sie im Stich lassen!«, sagte er und wies auf die kleinen Kinder und seine kranke Frau, die, mit einem Pelz zugedeckt, in einer Ecke lag.
Ich wusste nicht weiter. Doch mir war klar: Gesetz ist Gesetz, man musste es erfüllen. »Fahren Sie, wir kümmern uns schon«, versicherte ich ihm aufrichtig, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, wie und womit ich dieser Familie helfen könnte. Der Hirte lächelte traurig. »Du willst dich kümmern?«
»Ja, ich, unser Dorfsowjet …«
»Na schön, Junge«, sagte er seufzend. »Geh nur, ich komm schon irgendwie allein klar. Geh. Und hab keine Bange. Ich versorg sie nur ein wenig, dann schickt mich meinetwegen ans Ende der Welt.«
Niedergeschmettert kam ich zurück in den Dorfsowjet. Ich erzählte alles Turdubajew. Sein Gesicht verfinsterte sich. Immerfort presste er seinen Bart in der Faust. Er hatte so eine Angewohnheit.
»Was schlägst du vor?«, fragte er in tonloßem Bass.
»Helfen Sie«, sagte ich. »Sie brauchen Heizmaterial, Heu, und mit Mehl ists bei ihnen auch schlecht bestellt. Die Kleinen frieren, man sieht ihnen an, dass sie hungern.«
»Was nötig ist, weiß ich allein. Du hast ihnen Hilfe versprochen, im Namen des Dorfsowjets, nun sieh zu, dass du dein Versprechen erfüllst. Sonst werden uns beiden die Leute nicht mehr glauben. Geh zum Kolchosvorsitzenden und setz durch, dass sie dir ein Fahrzeug geben und Heu ranschaffen, Stroh zum Heizen. Setz durch, dass sie ihnen Mehl und Kartoffeln zuteilen. Der Mann muss morgen zum Arbeitseinsatz fahren und wissen, dass hier die Sowjetmacht ist. Mag der eine alt sein und der andre klein – immerhin sind sie die Macht.«
Es war nicht so einfach, dem Kolchosvorsitzenden das Erforderliche abzuringen. Ich hatte ihm gerade noch gefehlt! Er habe im Kolchos genug eigene Sorgen. Für alles sei er verantwortlich: Erfüll den Plan, gib dies und das. Niemand sagte dem Kolchos: Da, nimm! Immer nur: Gib! Um geben zu können, müsse man arbeiten. Aber mit wem? Wer solle arbeiten? Es gäbe niemanden, der auch noch Heu und Stroh für die Wirtschaften ausfahren könnte. Wenn der Mann zum Arbeitseinsatz müsse, dann solle er doch losziehen; schließlich sei er nicht der Einzige. Das ganze Land kämpfe. Alle Familien litten Not, lebten ärmlich.
Musste ich gerade im ungünstigsten Moment beim Vorsitzenden auftauchen? Dem Mann schmerzte auch so das Herz. Doch ich blieb hartnäckig, argumentierte, so gut ich konnte, bettelte. In meiner Verzweiflung war ich bereit, zur Heugabel zu greifen. Wir standen auf dem Pferdehof. Als ich schließlich gesagt bekam: Da sind Pferde, da ist Geschirr, Stroh findest du auf dem Feld, bei der Tenne, Heu steht dort in Schobern, wir haben keinen, ders wegfahren kann, kümmre dich selber – da stürzte ich mich auch schon in die Arbeit, spannte Pferde an, schmiss ein paar Heugabeln auf den Wagen und fuhr polternd auf die Straße hinaus. Ich musste mich beeilen. Ein Wintertag ging schnell zur Neige. Auf der Straße hielt ich kurz beim Haus meines Vetters, Païsbek Mombekow. Er lebte bei Verwandten, der Vater war in der Armee, die Mutter gestorben, Païsbek selber unterrichtete, wie bereits gesagt, in der Schule, fünfzehn Jahre war er alt. Ich hatte Glück: Païsbek war zu Hause. Zu zweit fuhren wir aufs Feld Stroh holen. Wir packten den Wagen übervoll. Unterwegs kippte er uns um. Wir spannten die Pferde aus, richteten den Wagen – wenn auch mit großer Mühe – auf und beluden ihn wieder mit dem Stroh. Gegen Abend, noch bei Tageslicht, rollten wir in den Hof des Hirten. Hoch auf der Fuhre thronend, sah ich, dass er in seinem Garten bereits viele Bäume gefällt hatte. Keinen verschonte er. Wir luden das Stroh ab, er aber schwang unentwegt die Axt. Schließlich trat er näher, verschwitzt, mit dampfendem Rücken.
Wir schwiegen, und da sagte er: »Danke, Jungs. Ich hab gerade Pappeln als Brennholz geschlagen. Ein wenig müssen sie trocknen, dann werden sie damit heizen können, während ich weg bin. Schade, die Bäume waren noch jung. Aber was hilfts. Nach dem Krieg pflanzen wir neue, so Gott will, sollen die dann groß werden.«
Ich reichte ihm ein Papier mit der Anweisung des Vorsitzenden, seiner Familie Mehl und Kartoffeln auszuhändigen. Ich erinnere mich genau – acht Kilo Schrotmehl und zwanzig Kilo Kartoffeln. Heu, versprach ich, würden wir am nächsten Tag morgens bringen.
»Verzeih, Bruder, dass ich mich neulich so ereifert habe«, sagte der Hirte betreten. »Mir war himmelangst: die Kinder noch so klein und die Frau in letzter Zeit oft krank. Sie hat sich in den Bergen erkältet. Sonst hätt ich ja kein Wort verloren …«
Païsbek und ich brachten eine Säge, und wir zersägten an jenem Abend noch lange die gefällten Pappeln zu Klötzen, damit man sie dann in Scheite hacken konnte.
Ich kam sehr spät nach Hause, unterwegs von Hunden verfolgt. Und nachts fand ich keinen Schlaf. Ich fürchtete, ich könnte verschlafen. Frühmorgens musste ich das Sammeln der Einberufenen und ihre Abfahrt ins Kreiszentrum überwachen. Doch das war es nicht allein. Verschiedene Gedanken machten mir den Kopf schwer. Ich dachte an den Krieg. Früher hatte ich ihn mir so vorgestellt: unentwegtes Maschinengewehrfeuer und Heldentaten über Heldentaten, die Feinde fallen wie niedergemäht, die Unsern sind gegen alles gefeit … Diese naive kindliche Illusion brach grausam zusammen. Kein Tag verging, ohne dass im Dorfsowjet »schwarze Papiere« eintrafen, Gefallenenmeldungen von der Front. Den Heldentod starb dieser, dann jener, der dritte, der vierte … Am schrecklichsten war, die Familien der Gefallenen zu benachrichtigen. Obwohl alte Aksakale die bittere Kunde mit gebührender Würde überbrachten und der ganze Ail jeden Gefallenen beweinte, war es doch meine Aufgabe, den Betroffenen das »schwarze Papier« auszuhändigen. Nicht gleich, erst später, nach dem ersten Ausbruch von Verzweiflung und Leid. Und doch wars schrecklich, der amtlichen, von meinem Vorgänger geerbten Feldtasche das handtellergroße Stück bedruckten Papiers mit dem Militärstempel und den Unterschriften von Majoren, Hauptleuten oder anderen Stabsoffizieren zu entnehmen. Der Text beanspruchte nur wenige Zeilen. Leise lese ich, übersetze die Worte ins Kirgisische und verstumme. Mir antwortet ein tiefer, hoffnungsloser Seufzer, als löse sich schurrend ein Steinschlag vom Berg, ehe er prasselnd talwärts stürzt. Mir fällt schwer, die Augen zu heben, auch wenn mich keine Schuld trifft. Ich übergebe das Papier. »Verwahren Sie es«, sage ich. Jäh wird das unterdrückte, verhaltene Weinen der Mutter von krampfhaftem Schluchzen zerrissen und geht über in langes, unendlich leidvolles Weinen. Soll ihr wirklich dieses Papier den lebendigen Sohn ersetzen?!
Ich kann weder aufstehen noch weggehen oder trösten. Welche Worte brächten hier Trost? In solchen Augenblicken möchte ich am liebsten aus der Tür stürzen, ein Maschinengewehr packen, ja, ein Maschinengewehr, und mit ihm ohne Atempause dorthin rennen, an die Front, woher dieses Papier kam. Um dort, vor Wut und Zorn rasend, die Faschisten reihenweise niederzuschießen, reihenweise, aus dem unerschöpflichen, nie verstummenden Maschinengewehr. Aber das geschieht nur in Gedanken. Wer gäbe mir schon ein Maschinengewehr, einem Jungen, der obendrein noch klein ist! Ja, wäre ich wenigstens größer!
Endlich gehe ich, bedrückt vom Leid mir nahestehender Menschen. Ich gehe, über der Schulter die Feldtasche vom Dorfsowjet. Darin aber sind noch andere Gefallenenmeldungen.
Von dieser amtlichen Tasche aus der Vorkriegszeit – solche Taschen trugen gewöhnlich reisende Bevollmächtigte – erzählte ich einmal einem Landsmann, dem bekannten kirgisischen Schriftsteller Aschim Dshakypbekow, Chefredakteur des Studios Kirgisfilm. Die Tasche hatte seinem älteren Bruder Aitaaly gehört. Aschim ging damals in eine untere Schulklasse. Aitaaly indessen war ein umgänglicher Bursche, er mied uns nicht, sondern organisierte Kriegsspiele, führte uns auf Feldzügen an; dann aber schoß er unversehens in die Höhe, wurde erwachsen und arbeitete kurz vor dem Krieg als Sekretär des Dorfsowjets. Später, als ich an der Reihe war, den Sekretärposten zu übernehmen, fragte mich Nukejew bei der Übergabe der Geschäfte: »Hast du denn eine Tasche? Worin willst du die Papiere austragen?« Natürlich besaß ich keine Tasche, in die Schule gingen wir damals mit den Büchern unterm Gürtel. Da kramte er diese Tasche vom Boden des Schranks aus einem Haufen alter Papiere. »Da, nimm. Das ist die Tasche von Aitaaly. Sie lag noch dort, wo er sie hingeworfen hatte, als er zur Armee ging. Nimm und benutz sie. Du wirst doch Papiere nicht in der Hand tragen …«
So kam ich zu dieser Tasche. In ihr entdeckte ich allerlei dienstliche Notizen, alte Quittungen, nicht ausgehändigte Benachrichtungen über die Besteuerung von Wirtschaften und zwischen alledem auch einen Brief in Versen, eine Liebeserklärung. Aschyktyk kat lautete der Titel dieser Botschaft. Offenbar war Aitaaly nicht mehr dazu gekommen, sie dem Mädchen zu überreichen, für das sie bestimmt war. Ich wußte nicht, was ich damit tun sollte. Der Name des Mädchens war nicht angegeben. Nur die Initialen. Mir schien es unangebracht, diesen Brief jemandem zu zeigen, ich zerriss ihn in meiner Naivität und in meinem Unverstand. Später bedauerte ich das sehr. Als die Nachricht von Aitaalys Tod an der Front in diese Tasche geriet, begriff ich das Unüberlegte meines Tuns.
Zu meinen Obliegenheiten gehörte es, an die Familien von Frontsoldaten nach einem Verzeichnis winzige Bündel von primitiven Streichhölzern aus einem Industriekombinat zu verteilen, selbstgefertigte, in kleine Stücke geschnittene Seife, Garn und Petroleum – »ein Medizinfläschchen« pro Familie.
Armut, Entbehrungen, Leiden. Wer dachte nicht: Ob all das jemals endet? Sind der Prüfungen noch nicht genug? Doch nicht darin bestand die schlimmste Prüfung. Das Volk bewies große, unbeschreibliche Tapferkeit, beugte das Haupt nicht vor dem grimmigen Antlitz des Krieges. Mochte das Leben so schwer sein, dass es mitunter schien, die Kraft reiche nicht mehr für noch ein Unglück, für immer neue Bürden, und die menschliche Geduld sei erschöpft – die Menschen gaben nicht auf, unternahmen wieder und wieder, was nur in ihrer Macht stand.
Viel ist schon über die Frau der Kriegsjahre gesagt worden. Gebührend und zu Recht hat man sie als Werktätige und Mutter gepriesen. Und dennoch: Wäre ich Bildhauer oder Maler, mein Leben widmete ich ihrer Darstellung, bemüht, meiner Dankbarkeit, meiner Begeisterung, meinem Stolz und meinem Mitgefühl für diese große Gestalt des zwanzigsten Jahrhunderts Ausdruck zu verleihen.
Ich erinnere mich, einmal erschien im Dorfsowjet ein Maler von außerhalb, ein älterer Mann. Für Mehl malte er Porträts von Stachanowarbeiterinnen. Assija Dubanajewa, unsere schöne, beste Gruppenleiterin, fröhlich und umgänglich von Natur, wirkte auf dem Bild völlig verändert. Sie sah sich ähnlich und doch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Porträt erhalten geblieben ist. Ein junges, schönes Gesicht mit Augen voller Unruhe und Leid. Wir standen neben dem Maler und sahen ihm bei seiner Arbeit zu. Jemand sagte ihm, die Assija auf dem Bild sei doch gar nicht ähnlich.
»Sie ist all denen ähnlich, die auf ihre Männer warten«, entgegnete der Maler.
Leider sah unsere Assija ihren Mann nicht wieder. Ihre Jahre verrannen mit Warten und Arbeit, Arbeit und Warten.
Halbwüchsige sind trotz allem große Kinder. Aber neben den Frauen nahmen in jenen Tagen gerade sie die Männersorgen ums tägliche Brot auf ihre noch unentwickelten, halb kindlichen Schultern. Die zwölf-, dreizehnjährigen Jungen von damals wurden Pflüger und Getreidebauern. Im Jahr 1942 beschloss unser Kolchos in Scheker, zusätzlich über zweihundert Hektar Neuland mit Sommergetreide zu bestellen. »Brot für die Front!« Damit war alles gesagt. Aus heutiger Sicht ist es überhaupt kein Problem, ein paar hundert Hektar zu pflügen. Man fährt einen Traktor auf das Stück Land, und die Sache ist erledigt. Damals aber, mit Pferden, bei den wenigen Pflügen im Kolchos, war es eine Heldentat, so viel Ackerland über den Plan hinaus umzubrechen. Ja, eine Heldentat! Ein Vierergespann mit einem Zweischarpflug schafft an einem Tag im Höchstfall einen reichlichen halben Hektar Brache oder Neuland. Da kann man sichs ausrechnen …
Die Pflügerjungen mussten aus diesem außergewöhnlichen Grund die Schule verlassen. Schon im Winter begannen sie nämlich die Pferde vorzubereiten. Ein Zugpferd braucht tägliche unermüdliche Pflege, sonst macht es schon in den ersten Tagen der Saatkampagne schlapp. Die Arbeit mit dem Pflug ist in der Landwirtschaft die allerschwerste. Auf dem Dorf weiß das jeder.
Um mit dem Pflügen und der Aussaat zurande zu kommen, zogen die Jungen in jenem Jahr bereits in den ersten Frühlingstagen aufs Feld. Der Boden begann gerade erst zu atmen. Genaugenommen war der Winter noch nicht vorbei. Ich erinnere mich, als wäre es heute – wir hatten Ende Februar.
Gleich in den ersten Tagen ritt ich auf das Neuland in der Kök-Sai-Steppe, um nach meinen Kameraden zu sehen. Als ich frühmorgens aufbrach, war der Tag grau und trüb. Am Ziel aber begann es unversehens heftig zu schneien. Die Flocken wirbelten, hüllten alles in Weiß. Und für alle Zeit hat sich mir seitdem das Bild der kleinen Pflüger im Schneegestöber eingeprägt. Die Flocken waren groß, fielen dicht und tauten schnell. Sie erfüllten einen riesigen, öden Raum, verhüllten den Blick auf die ganze weiße Welt. Stille herrschte ringsum, Menschenleere, da war nichts als lautlos fallender Schnee. Doch die Pflüger ließen sich nicht beirren, trieben unermüdlich die Tiere an. Einen schwarzen Ackerstreifen entlang, der einen Hügel überspannte, zogen die Pflüge dahin, als wären es Schiffe, die im Nebel steile Wellenkämme bezwingen. Sie verschwanden hinterm Hang, als sänken sie in Wogentäler. Dann hörte man nur noch die Jungenstimmen. Ich ritt zu ihnen hin.
Die Pflüge tauchten aus dem Schneegestöber. In die Furche geduckt, hastig atmend, stemmten sich die Vierergespanne voran. Der Schnee taute augenblicklich auf ihren heißen Rücken, wurde zu weißem Dampf. Schwer hatten es die Gäule, die Erde unter ihren Füßen war feucht und glitschig, das Geschirr klitschnass. Aber auch die Jungen, die sie antrieben, hatten es nicht leichter. Ihre Köpfe bargen sie unter nässeschweren Säcken. Diese Jungen waren ja noch halbe Portionen. Bei solchem Wetter hätten sie besser in einem warmen Winkel sitzen sollen. Doch sie waren Kriegskinder, sie wussten, das war ihr Los und ihre Pflicht.
Es schneit und schneit … Durch den weißen Flockenwirbel kriechen die schwarzen Gespanne mit den Pflügen. Keinen Augenblick bleiben die Pflüge stehen … Ich erkenne die Jungen an den Stimmen: Baitik, Tairybek, Satar, Anatai, Sultanmurat … Meine Klassengefährten. Lange zögere ich, mich ihnen zu nähern – sie sollen nicht sehen, dass ich weine.
Im Winter widerfuhr uns ein schreckliches Unglück. Nachts klopfte es heftig ans Fenster. Aus dem Sattel gebeugt, schrie jemand: »Aufstehn! Schnell zum Pferdestall! Sie haben uns Pferde gestohlen!«
Im Handumdrehn war ich angezogen und rannte los. Aus allen Häusern stürzten Leute, warfen sich im Laufen schnell was über. Als ich mich dem Pferdestall näherte, hörte ich laute, erregte Stimmen. Wie sich herausstellte, hatten um Mitternacht, als der wachhabende Pferdewächter eingeschlafen war, Unbekannte die beiden besten Pferde aus ihrer Box am Tor herausgeholt. Der Wärter hatte zunächst gedacht, sie wären zufällig losgekommen, und begriff erst, als er entdeckte, dass mitsamt den Pferden auch die Sättel verschwunden waren. Da stürzte er hinaus, doch es war zu spät.
Wir mussten die Pferdediebe erwischen. Ohne erst zu satteln, sprang jeder auf irgendein Pferd, und schon preschten wir in verschiedenen Richtungen davon, ihnen nach. Was hätten wir schon tun können, wenn wir sie wirklich eingeholt hätten? Kein Pferdedieb hätte sich vor uns Jungen gefürchtet! Bis zum Morgengrauen durchsuchten wir Schluchten, Mulden und verlassene Winterhütten, aber nirgends fanden wir auch nur eine Spur. Es waren erfahrene Diebe. Wir waren fassungslos: Da hatten wir die Pferde für die Frühjahrsaussaat vorbereitet, hatten deswegen die Schule aufgegeben, und dann fanden sich Leute, die alles kaltließ.
Ich bemühe mich, möglichst zurückhaltend und lakonisch zu schreiben, denn es würde die Grenzen des Genres sprengen, wollte ich in allen Einzelheiten erzählen, was sich in jenen Jahren in unserem Scheker zutrug. Ich will versuchen, die Menschen und die Ereignisse zu gruppieren. Über meine Altersgefährten aus dem Dorf könnte ich noch viel Interessantes und Wissenswertes berichten, denn wir gehörten zu jener Generation von Halbwüchsigen, die schon am Tag nach dem Kriegsausbruch die Welt der Kindheit mit dem Strudel des Kriegslebens vertauschte, mit der leidvollen Wirklichkeit des Hinterlands; sie aber forderten von uns die Reife und den Mut von Erwachsenen.
Denke ich an meine damaligen Altersgefährten, dann gelange ich heute zu dem Schluss, dass meine Generation möglicherweise gerade durch die rauhen Verhältnisse so lebenstüchtig und charakterfest geworden ist. Das soll keineswegs heißen, der heutige materielle Wohlstand beeinträchtige die Lebenstüchtigkeit der Jugend. Im Gegenteil. Nur Unverstand verkehrt Gutes in Schlechtes. Jede Zeit stellt an den Menschen ihre Anforderungen, jede hat ihre Probleme, und daher ist das Leben niemals leicht, wenn man es ernst nimmt, etwas wagt und nicht bloß nach einem sorglosen Dasein trachtet. Ein Mensch, der in den Tag hinein lebt, stirbt als Persönlichkeit. Dabei konnten wir damals von solchen Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung, wie es sie heute gibt, nicht einmal träumen. Aber eigentlich geht es gar nicht darum. Ich möchte einfach sagen, dass unter meinen Altersgefährten aus der Kriegszeit nicht einer war, für den ich mich heute schämen müsste. Nicht ein einziger. Sie alle haben längst Familien, zumeist auch schon erwachsene Kinder, jeder geht seiner Arbeit nach, und ich bin sehr froh, sagen zu können, dass ihre Lebenswege von großer menschlicher Würde geprägt sind. Wen ich auch nehme, ich kann mich für jeden verbürgen. Die Brüder Taissarijew – die »Pflüger« Baitik und Tairybek – werken bis zum heutigen Tag, ohne die Hände in den Schoß zu legen, sind geachtete Männer im Ail, Kommunisten. Baitik ist Gruppenleiter, ein in der ganzen Republik angesehener Tabakbauer. Tairybek ist in der Feldwirtschaft ebenso unentbehrlich wie in der Viehzucht. Über Païsbek Mombekow sprach ich bereits – dreiunddreißig Jahre ist er Lehrer gewesen, ehe er vor zwei Jahren starb. Toktogul Ussubalijew hat es vom Rechnungsführer zum Kolchosvorsitzenden gebracht. Heute leitet er den Kolchos im benachbarten Bakaïr. Abdaly Nuralijew, ehemals Komsomolarbeiter, ist Kolchosaktivist. Toktogul Mambetkulow und Batima Orosmatowa unterrichten nun schon viele Jahre an der Schule die Kinder von Scheker. Nurija Dsholojewa und Orosgul Ussubalijewa arbeiten in fernliegenden Kreisen gleichfalls als Lehrer. Alymseït Doolbekow ist ein schon langjährig erfahrener Veterinärhelfer. Shaparbek Dossalijew arbeitet in einem Forstwirtschaftsbetrieb. Turgunbai Kasakbajew ist Vorsitzender eines der größten kirgisischen Kolchose. Im Kolchos Rossija gibt es allein sechzigtausend Schafe. Mirsabai Dsholdoschewa ist Hauptbuchhalterin eines ebenfalls sehr großen Kolchos in unserem Kreis Kirowskoje. Gapar Medetbekow ist ein bekannter Schauspieler am Dramatischen Theater von Naryn geworden …
So haben sich unsere Schicksale gefügt. Unter unsäglichen Mühen, aber nicht ziellos. Bei dem großen kasachischen Dichter Abai heißt es, das Leben gleiche der Bewegung des Meeres: So wie dort eine Wogenkette hinter der anderen herrolle, so folge auf die Welle einer »vorangegangenen Generation« die nächste, darauf die übernächste und so fort, ohne Ende. Und das Meer lebt.
Wenn ich an die Kriegsjahre zurückdenke, gelange ich zur Überzeugung, dass in unserer ethischen Entwicklung die »vorangegangene Welle« die entscheidende Rolle gespielt hat – die ältere Generation, die Generation der Frontsoldaten. Darüber könnte man sehr viel erzählen. Natürlich sind die Generationen stets miteinander verbunden. In friedlichen Zeiten vollzieht sich dieser Prozess auf natürliche Weise mittels Weitergabe von Erfahrungen und Traditionen. Im Krieg wurde das alles jäh unterbrochen. Unser stilles Scheker am Fuße des ewigen Manas, umgeben von Bergen, sah sich plötzlich im Strudel von Ereignissen, die die Welt erschütterten. Unsere Menschen, zum Schutz des Vaterlands aufgerufen, strömten an die Fronten, uns erreichten die Wogen der Evakuierten. Jenseits der Berge aber, durch die Bahnstation Maimak, die uns mit der Außenwelt verband, durch die nächstgelegene Stadt Dshambul, fuhren Tag und Nacht Militärzüge in die eine und in die andere Richtung – nach West und nach Ost. Hier pochte dröhnend der fiebrige Puls des kämpfenden Landes.
Einer der ersten, der uns aus eigener Erfahrung vom Krieg erzählte – von der Front, von Panzerangriffen, Bombenexplosionen und Waldbränden, vom Erlebnis der Schlachten, von Lazaretten und Militärchirurgen, von Tod und Tapferkeit –, war unser berühmter Ail-Sänger, der Dichter Myrsabai Ukujew. Er ist längst dahingegangen. Die Lieder von Myrsabai Ukujew aber kennt und singt man im Umkreis des Manas bis zum heutigen Tag.
Myrsabai Ukujew war der erste verwundete Frontsoldat, den unser ganzer Ail voller Freude, aber auch mit Bestürzung empfing, denn er wurde vom Wagen gehoben und bekam Krücken unter die Arme gesteckt: ihm fehlte ein Bein. Dergleichen hatten wir noch nie gesehen. Lahme und Krumme, die ja. Aber dass ein Bein hoch überm Knie einfach weg war, das war zumindest uns Jungen noch bei keinem begegnet. Es war schrecklich.
Früher einmal war er ein junger, schöner Lehrer gewesen. Er ritt auf einem grauen Passgänger, und sein Ross hieß Myrsabais dshorgo. Myrsabai sang gern und dichtete auch eigene Lieder, während er in die Saiten seiner Tschertmek griff. Und nun war er ohne Bein zurückgekommen; unnatürlich bleich von Lazarettaufenthalten und Bahntransporten, stand er auf Krücken inmitten der Dörfler, lächelte und weinte mit allen.
An jenem Abend sang Myrsabai vor einer großen Volksmenge Frontlieder, die er im Lazarett verfasst hatte. Das war für uns ein großes Ereignis, hat sich mir fürs ganze Leben eingeprägt. Wir alle waren ergriffen von Myrsabais Gesang, von seinem poetischen Bericht über den Krieg. Die Menschen lauschten mit angehaltenem Atem, gedachten der Ihren, die an die Front gegangen waren, lauschten und wischten sich Tränen ab. Er sang von sich, von seinen Regimentskameraden, doch das waren Lieder auch über einen jeden von uns, über das ganze Volk.
Stegreifpoesie ist schwer zu übersetzen und nachzuerzählen. Die Verskunst eines Akyn bezieht ihren Zauber daraus, dass man ihr Entstehen miterlebt – aus der Gleichzeitigkeit von Schöpfung und Vortrag. Dennoch will ich es versuchen. (Söhne verschiedener Völker – Russen, Kasachen, Usbeken und Kirgisen –, kamen wir uns in der Armee näher als Blutsverwandte. Wir haben eine Mutter – unsere Heimat; mit ihrer Milch hat sie uns alle genährt. Wie könnte unser Herz stumm bleiben, ihr Dshigiten, wenn unserer Mutter Unheil widerfährt? Gibt nicht sie uns Auftrieb, wenn wir einen steilen Berg hinauf müssen, schenkt nicht sie uns Hoffnung, wenn wir einen steilen Berg herunter müssen? Schwören wollen wir, wie unsere Helden einst schworen: Fällt uns der Tod, dann werden wir alle auf demselben Feld liegen, erringen wir den Sieg, dann werden wir alle auf demselben Berg stehen. So sprachen wir zueinander, während wir uns durch Wälder den Stätten näherten, wo wir auf die Faschisten stoßen sollten. Schon dröhnte unter unseren Füßen die Erde wie bei einem gewaltigen Erdbeben. Schon fielen Bomben, jagten mit ihrem grässlichen Heulen die Seele aus dem Körper und ließen schwarzen Staub gen Himmel stieben. Wir warfen uns in die Schlacht bei Leningrad …)
Das sang er seinen Ail-Gefährten. Besonders schön und rührend fanden wir jene Stelle in Myrsabais Geschichte, wo der Militärzug auf der Fahrt von Nowosibirsk an die Front offenbar seine Route änderte und unversehens auf jene Bahnstrecke geriet, die durch unsere Station Maimak führt. Im Morgengrauen passierte er, ohne die Geschwindigkeit zu vermindern, ohne Halt auf dem Bahnhof, die Maimak-Schlucht, den Tunnel, vorbei am Talas-Kamm, am Manas. Und offenbar improvisierte damals Myrsabai folgende Verse, die uns besonders erschütterten und seither zum Lied unseres Ails geworden sind. Es waren Abschiedsworte an die Berge des Alatau:
Meinem Blick entschwindet schon der Alatau,
der schneeblaue, wasserspendende Alatau.
Meinem Blick entschwindet schon unser Manas,
der weißhäuptige, väterliche Berg Manas.
Auf Wiedersehn, schneeblauer Alatau,
wünsch deinen Söhnen den Sieg über den Feind.
Auf Wiedersehn, väterlicher Berg Manas,
wünsch deinen Söhnen den Sieg über den Feind.
Gespiegelt in meinen Augen, nehm ich euch mit –
dich, schneeblauen, wasserspendenden Alatau,
dich, weißhäuptigen, väterlichen Berg Manas …
Wie oft haben wir dieses Lied dann als Willkommens- und Abschiedsgruß gesungen!
In jenem Winter gaben wir den achtzehnjährigen Burschen das Geleit. Noch gar nicht lange war es doch her, dass wir gemeinsam herumgetollt waren. Mochten sie auch ein wenig älter sein – sie waren einfach unsere Spielkameraden, unsere Gefährten gewesen. Jetzt zogen sie an die Front. Mit ihnen Dshumabai Orunbekow, mein Verwandter und Freund. Blutjung war er noch. Er hatte die Schule besucht, dann im Kolchos gearbeitet. Das war auch schon sein ganzes Leben, das er auf dem Schlachtfeld dahingab. Ich erinnere mich, wie er dieses Lied anstimmte, als die Jungen im Leiterwagen Platz genommen hatten.
Gespiegelt in meinen Augen, nehm ich euch mit –
dich, schneeblauen, wasserpendenden Alatau,
dich, weißhäuptigen, väterlichen Berg Manas
Und los ging die Fahrt, die Straße lang durch den Ail. Ihre Angehörigen liefen hinterm Wagen her. Nur Myrsabai blieb stehen, auf seine Krücken gestützt, und lauschte dem Abschiedslied an die Heimat, das noch lange zu ihm herüberscholl.
Myrsabai Ukujew genoss in unserem Ail wahrhaft große Achtung und Verehrung. Kein Ereignis ging ohne ihn vonstatten – ob Kolchosversammlung (von seiner Rückkehr bis ans Ende seiner Tage war er Rechnungsführer und ständig Mitglied der Parteileitung), ob Familienfeierlichkeiten, Willkommens- oder Abschiedsfeste –, in Freud und Leid für den Ail war Ukujew stets gern gesehen, wurde er gebraucht, gehörte er einfach dazu. Mit einem klugen Wort, einem Lied flößte er den Menschen Hoffnung ein, ließ er sie an den Sieg glauben und für ihn kämpfen.
In unserem Ail waren Groß und Klein stolz auf ihn und kannten seine Frontbiografie. Sie wussten die Namen aller, die mit ihm gedient hatten, wussten, wer sie waren und woher sie gekommen, sie kannten seine Kommandeure, denn von alldem handelte sein gesungenes Poem über den Krieg. Alle wussten auch, wie und unter welchen Umständen er verwundet, von wem er gerettet worden war.
Das war in den Wäldern um Leningrad geschehen, wohl im Sommer oder Herbst 41. Bei einem Gefecht explodierte eine Granate in nächster Nähe. Er erinnerte sich noch, wie etwas gegen sein Knie schlug. Als er wieder zur Besinnung kam, dauerte das Gefecht noch an, ringsum dröhnte alles von der Schießerei und den Detonationen. Er blutete stark, war außerstande, sich zu bewegen und wollte schon Abschied nehmen von der Welt – da erreichte ihn kriechend eine Sanitäterin. Das russische Mädchen Tanja. Im Ail nannten alle sie Tanija. Wenn doch unsere Tanija wüsste, wie Myrsabai Ukujews Dorfgenossen sie bewunderten, sie liebten! Schade, heute ist nicht mehr festzustellen, wer diese Tanja war, denn Myrsabai Ukujew lebt nicht mehr. Sie schaffte es, ihn zu verbinden und vom Schlachtfeld zu tragen. Über sie sang uns Myrsabai:
Welche Mutter nur gebar ein Mädchen,
dessen Güte keine übertrifft auf der Welt …
Jene Frau lieb ich mehr als die leibliche Mutter.
Welcher Vater nur erzog solch ein Mädchen,
dessen Kühnheit keine übertrifft auf der Welt …
Jenen Mann lieb ich mehr als den leiblichen
Vater …
Diese Zeilen zitiere ich freilich in sehr freier Übersetzung. Stegreifpoesie, die so sehr davon lebt, durch den Vortrag des Verfassers die Zuhörer unmittelbar zu erreichen, soll man vielleicht nicht schriftlich festhalten. Auf dem Papier stirbt sie wie eine zwischen den Seiten eines Buches vertrocknende Blume.
Die Nachkriegsjugend von Scheker schuldete Frontsoldaten wie Myrsabai Ukujew Dank. Er nahm es sich sehr zu Herzen, dass wir die Schule aufgeben mussten. 1944, als der Krieg bereits nach Westen gerollt war, als nach und nach arbeitsverpflichtete Männer und viele verwundete Frontsoldaten heimkehrten, beeilte sich Myrsabai, uns wieder zum Lernen zurückzuschicken. Ein Teil von uns setzte sich zu der Zeit schon wieder auf die Schulbank. Nach dem Krieg fuhr ich zum Studium am Zootechnikum nach Dshambul. Es war, ich muss schon sagen, eine sehr, sehr schwere, eine Hungerzeit. Eines Tages rief man in einer Pause zwischen den Lehrveranstaltungen nach mir: »Dich sucht ein Mann auf Krücken!« Ich lief auf den Hof – es war Myrsabai-aka. Lächelnd strich er sich über den Schnurrbart. Auch ich freute mich sehr.
»Ich hatte in der Stadt zu tun, im Materiallager, da dachte ich mir, ich schau mal nach, wie du mit der Wissenschaft klarkommst.«
Ich erzählte ihm von unserem Leben und Treiben. Er war zufrieden.
»Komm mit auf die Straße«, sagte er und humpelte vom Hof. »Ich hab dir was mitgebracht, es liegt im Wagen.«
Wir gingen zum Tor.
»Ich weiß doch, dass ihrs nicht leicht habt jetzt«, sagte er, »sehr schwer sogar. Laß dirs trotzdem nicht einfallen, das Studium hinzuschmeißen. Dazu haben wir jetzt kein Recht. Der Krieg ist zu Ende. Wenns gar zu schlimm wird, gib mir Bescheid. Wir lassen uns im Ail was einfallen. Aber lernen musst du.«
Ein Altersgefährte und Freund von Myrsabai Ukujew, für uns damals eine ebensolche Respektperson wie er, war der erste Mähdrescherfahrer unseres Ails, der alte Kommunist Toilubai Ussubalijew. Heute ist Toiluke-Aksakal, wie wir ihn nennen, Großvater einer zahlreichen Enkelschar. Sein Sohn, Sati Toilubajew, ist Hirte einer Eliteschafherde im Sowchos Kök-Sai. Satis Kinder wachsen heran wie eine ganze Abteilung. Große Achtung genießt Toilubai Ussubalijew bei seinen Nachkommen. Doch am Vorabend des dreißigsten Siegesjubiläums möchte ich die jungen Leute zusätzlich daran erinnern, dass Toiluke in den Kriegsjahren einer der wenigen war, die man ihren Bitten zum Trotz nicht an die Front schickte – er war für mehrere Kolchose der einzige Mähdrescherfahrer. Und wie er auf dem Mähdrescher arbeitete, ist längst Legende geworden. Niemand hielte jetzt so etwas für möglich, eine derartige Mähdrescherruine würde man heutzutage gar nicht erst reparieren, sondern sofort verschrotten, er aber übertrug die eigene Lebenskraft auf diese Ruine und erfüllte seine Pflicht. Es ist sein Mähdrescher, der in meiner Novelle Dshamilja eine Rolle spielt. Im Sommer 1944, während der Erntekampagne, war ich sein Gehilfe. Solange der Mähdrescher zu tun hatte, und seis Tag und Nacht, gönnten wir uns keine Ruhepause. Die Front musste versorgt werden, das Getreide duldete keinen Aufschub … Es war der heroischste Sommer meines Lebens. Nie werde ich jene Tage vergessen.
Und wieder ein Lied. Schon grünt das Gras am Wegrand, schon ziehen Herden mit ihrem Nachwuchs über die Berglehnen, die Hänge. Bestellte Felder huschen vorbei wie Spiegel – hier Wintersaaten, dort Hackfrüchte … Und wieder Felder, hier Hackfrüchte, dort Wintersaaten … Hinter mir zurück bleibt Dshambul, der unaufhaltsam wachsende, vom modernen Tempo der Urbanisierung erfüllte einstige Karawanenstützpunkt Aulije-Ata. Von hier aus fuhren meine Landsleute in Militärzügen an die Front, hierher, zur Eisenbahn, brachten wir unser Brotgetreide für die Front. Und da, unter den Wolken vor mir, erkenne ich bereits die Schneefelder des Manas.
Der Erste Sekretär des Dshambuler Gebietsparteikomitees, Assan Bekturganowitsch Bekturganow, während der Verteidigung Moskaus Politleiter einer Schikompanie, erzählte mir einmal, das Vermächtnis der Gefallenen an die Soldaten des Regiments laute: das Leben so zu gestalten, dass man der Toten mit Stolz und reinem Gewissen gedenke.
Das gleiche könnten wir auch von uns sagen, von dem zahllosen Volksheer im Hinterland während der Kriegsjahre. Daran musste ich unterwegs denken, die Schneefelder des väterlichen Berges Manas-Ata vor Augen.
(Essay für die Illustrierte Ogonjok, Nummer 19, 1975. Deutsch von Charlotte Kossuth.)
Alle Texte aus dem Band Karawane des Gewissens – Autobiographie, Literatur, Politik (Unionsverlag, 1988)
© by Unionsverlag, Zürich