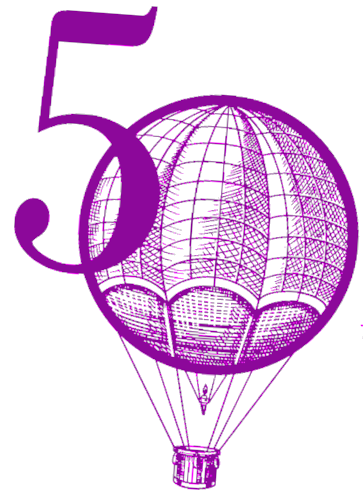WEIL DIE WELT WEIT IST …
50 Jahre Unionsverlag
Dankrede von Adam Zagajewski
Anläßlich der Verleihung des Literaturpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung 2002
| KAS-Literaturpreis 2002 | |
| Dankrede von Adam Zagajewski | |
| anläßlich der Verleihung des Literaturpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung 2002 | |
| von Adam Zagajewski Weimar, 2. Juni 2002 | |
| Warum verleiht man literarische Preise an Dichter? Ich glaube, ich kenne die Antwort: Man will von ihnen hören, was sie eigentlich meinen, wenn sie ihre Gedichte schreiben. Sonst ist man ein bißchen unruhig, denn die Gedichte sind immer vieldeutig: man hört in ihnen eine Stimme, eine menschliche, warme Stimme, aber sie sind zugleich kalt und gleichgültig wie ein Tischblatt im Januar, am Morgen (sie müssen so sein, wie könnten sie sonst überleben, wenn wir das Buch zumachen?). Sie haben nicht eine, sondern zwei Naturen, eine die fast menschlich ist und eine, die der der harten Gegenstände ähnelt. Sogar die Lyrik, die überhaupt keine hermetische Absicht verkündet, bleibt immerhin ein wenig rätselhaft. Ein literarischer Preis, und ihm folgende Dankrede, sind dann die angenehmste Methode, dem Autor ein Geständnis, eine Erklärung, abzugewinnen. Sogar die schweigsamste Dichter, sogar ein Paul Celan, werden beredt - oder zumindest weniger diskret - wenn man ihnen die intensive, wohltuende Aufmerksamkeit einer Laudatio bietet. Wieso sind die Lyriker diskret, warum hassen sie alle direkte Fragen, wie zum Beispiel die Frage - "was haben Sie in dieser Zeile sagen wollen?" Ist es nur eine Taktik, sich interessanter zu zeigen als man wirklich ist? Ist es die Scham? Oder Unwissenheit? Es geht um keine Taktik hier, es geht um die Scham und um die Unwissenheit. Die Scham - weil in einem Gedicht etwas gesagt ist, was man im Tageslicht "mit anderen Worten" - wenn das nur möglich wäre! - wieder zum Vorschein bringen nicht will. Die Scham, weil man das hohe Wort nur einmal und nicht fünf mal aussprechen kann. Das ist auch die Frage der Temperatur - das Gedicht entsteht in den Tropen der Eingebung, der Kommentar aber geschieht in einer Temperatur, die wir als typisch für Berlin oder Krakau bezeichnen könnten. Und dann die Unwissenheit; die Scholastiker kannten die feine Unterscheidung zwischen "finis operis" und "finis operandis", zwischen dem Ziel des Werkes als solches und dem Vorsatz des Autors - sie decken sich nicht und der Autor kann nicht alles wissen darüber, was er tatsächlich produziert hat. Und auch das: der Autor hört viele Stimmen, nur die eine nicht - seine eigene. Dieselbe seltsame Ignoranz spürt man sogar dann,wenn man die Lyrik unterrichtet; wenn ich große Lyriker meinen Studenten in Houston vorzustellen versuche, bin ich öfters verlegen und suche nach einem delikaten Gleichgewicht zwischen dem Gedicht, so wie es auf der Seite und im Vorlesen erscheint, und dem intellektuellen Kommentar. Ich will sie aber nicht im Stich lassen, nur im Negativen, nur in einer negativen Theologie der Poesie, obwohl sie mir ganz lieb ist. Denn es gibt Gedichte, die man kommentieren darf und soll und die trotzdem ihre innere Energie immer noch sieghaft bewahren. Und dann, aus einer Art Dankbarkeit, daß wir sie beachten, sagen sie uns etwas über uns selbst. Lesen wir das Gedicht von Guillaume Apollinaire, "La jolie rousse", "Die hübsche Rothaarige" (Deutsch von Fritz Usinger): Vor allen bin ich ein Mann voll Vernunft der das Leben kennt und von dem Tode das was ein Lebender Nachdem er die Schmerzen und die Freuden der Liebe gefühlt Der mehrere Sprachen kennt Nachdem er nicht wenig gereist ist Nachdem er den Krieg in der Artillerie und der Infanterie Verwundet am Kopf trepaniert unter Chloroform Nachdem er seine besten Freunde in dem schrecklichen Ich weiß von Altem und Neuem so viel wie ein einzelner Und ohne mich heute über diesen Krieg aufzuregen Unter uns und für uns meine Freunde Rechne ich diesen langen Streit der Überlieferung und Der Ordnung des Abenteuers Ihr deren Mund gemacht ist nach dem Bilde des Mundes Des Mundes der die Ordnung selbst ist Seid nachsichtig wenn ihr uns denen vergleichet Die die Vollendung der Ordnung waren Wir die wir überall das Abenteuer suchen Wir sind nicht eure Feinde Wir wollen uns weite und seltsame Reiche geben Wo das Geheimnis in Blumen sich jedem darbietet der es Es gibt da neue Feuer nie gesehene Farben Tausend unwägbare Phantasmen Denen man Wirklichkeit geben muß Wir wollen die Güte erforschen gewaltiges Land darin Es gibt auch die Zeit die man wegjagen oder wiederkommen Mitleid für uns die wir immer an den Grenzen kämpfen Des Unbegrenzten und der Zunkunft Mitleid für unsere Irrtümer für unsere Sünden Siehe der Sommer kommt die heftige Jahrzeit Und meine Jugend ist gestorben so wie der Frühling O Sonne es ist die Zeit der glühenden Vernunft Um ihr zu folgen immer auf die adlige und süße Form Die sie annimmt damit ich sie liebe allein Sie kommt und zieht mich wie das Eisen der Magnet Ihre Haare sind von Gold man könnte sagen Ein schöner Blitz der dauert Oder jene Flammen die stolz tun In den welkenden Tee-Rosen Aber lachet lachet über mich Menschen von überall besonders Leute von hier Denn es gibt so viele Dinge die ich euch nicht sagen darf So viele Dinge die ihr mich nicht sagen lassen würden Habet Mitleid mit mir Es gibt vieles, was ich in diesem Gedicht bewundere. Was ich auch mag (es ist ein spätes Gedicht von Apollinaire,der, an der Front schwerverletzt, am letzten Tag des Krieges, am 11. November 1918, der Spanischen Grippe erlag), ist etwas unerhörtes: die Klage eines Avantgardisten - und wir wissen, daß Apollinaire einer der Hauptavantgardisten war! - die Klage, die Bitte um Mitleid, um Verständnis. Normalerweise ist die Sprache der Avantgarde das Prahlen, und nicht das Lamentieren. Wir finden hier eine Anspielung an zwei Kriege: an den wirklichen, grausamen Krieg 1914-1918, und an die "Querelle des Anciens et des Modernes", den Streit der Alten und der Modernen, den das späte 17. Jahrhundert inszenierte, zuerst in Frankreich, wo eine Debatte zwischen Charles Perrault und Nicolas Boileau ausbrach. Sie schlug sich auch in Jonathan Swift´s "The Battle of the Books" nieder. In dieser Debatte ging es nicht nur um literarische Sachen - wer besser schrieb, die Alten oder die Modernen -, sondern auch um zwei Weltbilder, das tragische der Alten oder das eher pragmatische der Modernen. Die Avantgarde ist in Apollinaire´s Gedicht als Glück und als Verhängnis zugleich begriffen. Als Glück, weil sie das Neue, das Unerforschte uns öffnet, und auch als Besorgnis, weil sie den Zugang zu anderen,düsteren Bereichen der menschlichen Erfahrung schließt, und auch weil sie den Künstler von dem "Menschen aus der Straße" radikal isoliert. Die Avantgarde, die Apollinaire kannte und programmierte, war optimistisch; wie konnte der Dichter den Horror des Krieges mitteilen, wenn die Doktrin, die er selbst mitgestaltet hatte, es nicht zuließ. (Viele seiner Kriegsgedichte klingen wie Berichte aus einem Quatorze Juillet Fest in Paris.) Von heutigem Standpunkt gesehen, ist das, was Apollinaire hier schildert, eine alte Geschichte; die Avantgarde ist inzwischen greisenhaft und tief pessimistisch geworden, der Krieg, auch der zweite Weltkrieg, ist vorbei - und trotzdem kann ich mich in diesem Gedicht ohne weiteres erkennen. Sollen nicht die Lyriker unserer Generation auch um Mitleid bitten - weil sie ebenso mit der Form, mit dem Zeitgeist (den es nicht gibt und den muß man doch berücksichtigen) kämpfen müssen, wie Apollinaire und seine Zeitgenossen? Sind die Lyriker unserer Zeit nicht lächerlich, wenn sie den neuen und den alten Horror ausdrücken wollen, und die Güte und die Freude ebenfalls - und doch nur über bescheidene poetische Instrumente verfügen, so weit von Homer entfernt wie es nur denkbar ist. Das Erhabene ist ihnen verboten, weggenommen. Das Triviale ist ihnen geblieben, und die Ironie. Und hoffentlich auch der Humor. Die reiche, klassische Form ist nicht mehr vorhanden. Und wäre sie vorhanden, was würde das ändern? Befinden sie sich nicht, ein wenig wie Apollinaire, zwischen dem Alten und dem Neuen (nur daß sie an das Neue nicht mehr ehrlich glauben können), zwischen der Vergangenheit, die uns so viel sagen kann, und der schweigsamen Zukunft? Suchen sie immer noch nach der "höchsten Instanz", wie der verzweifelte französische Dichter? Der seltsame Scherz in Apollinaire´s Gedicht, in dem die "höchste Instanz" zuerst die Vernunft ist, die bald eine "hübsche Rothaarige" wird, kann heute viel häufiger passieren, ja, passiert jeden Tag. Wissen wir, ob die höchste Autorität Gott ist, oder die Vernunft, oder die Poesie? Die Mode, die Laune? Eine Rothaarige, vielleicht aus Hollywood? Sind wir nicht lächerlich, die wir in kleinen, hermetischen Zeitschriften die Menschheit retten wollen (wenn wir sie retten wollen),indessen schlummert die Menschheit in dem violetten Licht des Fernsehers. Lächerlich, ja, und dennoch - was sollen wir sonst tun? Die Zivilisationsprognosen sind nicht gut, die Literatur befindet sich angeblich im Absterben. Aber bitte, kündigen Sie das einem jungen Lyriker - oder einer Lyrikerin an, der beziehungsweise die 22 Jahre alt ist und so viel zu sagen hat! Wir wissen nicht, was Poesie ist - und das ist erfreulich. Es gibt ein chinesisches Zeichen, habe ich gelesen, das zugleich "die Musik" und "die Freude" bedeutet. Das hat mir sehr gefallen. Das selbe Zeichen könnte auch Tragödie bedeuten, Kontemplation der sichtbaren und unsichtbaren Dinge, die Überlegung über Geschichte, die Ekstase, ein Liebesbekenntnis, den Glauben, die elegische Traurigkeit - und dann würden wir sagen, es ist ein gutes Zeichen für die Poesie. Die Musik und die Freude - beide brauchen wir. Die Musik liebe ich sehr, manchmal aber, wenn ich die Gedichte einiger meiner Zeitgenossen lese, sehe ich, daß man ihr, der Musik, einen religiösen Rang zuerkennt - um auf diese Weise die gnadenlose metaphysische Lücke auszufüllen. Dagegen sollten die vernünftigen Musiker protestieren... Es gibt aber auch eine andere Musik, die leise Musik der letzten Fragen, und die hört man in der Poesie, wo sonst. Wir machen die Poesie aus dem, was wir sind - und dabei, wie ein kleinstädtischer Magier, fügen wir heimlich hinzu eine Prise dessen,was wir nicht sind. Das Deutschtum habe ich zuerst von der bösen Seite kennengelernt, nicht als Zeuge, dafür bin ich zu spät geboren, sondern als der Sohn, dessen Eltern manches erlebt hatten. Als ich Kind war, war Konrad Adenauer für mich und meine Altersgenossen ein Gespenst, ein Monstrum - weil er uns natürlich so in der kommunistischen Propaganda gezeigt worden war. Dann aber habe ich das andere Deutschland gekannt - in den Büchern und in der Musik. Und jetzt bin ich froh, daß ich mich inmitten dieses anderen Deutschlands befinde, in Weimar. Auch Konrad Adenauer hat für mich inzwischen ein anderes Gesicht bekommen, das wahre Gesicht eines Europäers. Zuletzt erlauben Sie mir, Ihnen ein Gedicht vorzulesen. Denn ein Lyriker soll eher so sprechen. Das Gedicht heißt "Versuch`s, die verstümmelte Welt zu besingen" und wurde von Karl Dedecius ins Deutsch übertragen: Versuch`s, die verstümmelte Welt zu besingen. Erinnere dich an die langen Junitage, und an die Erdbeeren, die Tropfen des Weins rosé. An die Brennesseln, die methodisch die verlassenen Behausungen der Vertriebenen überwucherten. Du musst die verstümmelte Welt besingen. Du hattest die eleganten Jachten und Schiffe betrachtet; eins davon hatte eine lange Reise vor sich, ein anderes erwartete nur das salzige Nichts. Du hast die Flüchtlinge gesehen, die nirgendwohin gingen, Du hast die Henker gehört, die fröhlich sangen. Du solltest die verstümmelte Welt besingen. Denke an die Augenblicke, als ihr beisammen ward in dem weißen Zimmer, und die Gardine sich bewegte. Erinnere dich an das Konzert, als die Musik explodierte. Im Herbst sammeltest du Eicheln im Park und die Blätter wirbelten über den Narben der Erde. Besinge die verstümmelte Welt und die graue Feder, die die Drossel verlor, und das sanfte Licht, das umherschweift und verschwindet und wiederkehrt. | |
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 2002-06-04 | |